|
|
Verwaltungsanweisung Hilfe zur Pflege
Vorwort 1
Mit dieser Verwaltungsanweisung wird geregelt, unter welchen Bedingungen Leistungen der Hilfe zur Pflege gem. §§ 61 – 66a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) unter Einbeziehung vorrangiger Leistungen zu bewilligen sind.
Die Verwaltungsanweisung gliedert sich in fünf Teile:
Erster Teil: | Leistungen der sozialen Pflegeversicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) |
Zweiter Teil: | Allgemeine Bestimmungen der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
Dritter Teil: | Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII |
Vierter Teil: | Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII |
Fünfter Teil: | Inhalte der Pflegereformen |
Im Anhang der Verwaltungsanweisung befindet sich ein Hinweis über die Suchfunktion sowie das Verzeichnis weiterer Links (Rundschreiben, Hinweise, Richtlinien, u. ä.).
Leistungsberechtigt nach dem SGB XI ist, wer:
und
In der Pflegeversicherung sind kraft Gesetzes alle versichert, die in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind.
Die Regelungen des § 264 SGB V sind nicht auf die Pflegeversicherung anzuwenden.
Die Vorversicherungszeit gilt als erfüllt, wenn der Versicherte in den letzten 10 Jahren vor der Antragstellung mindestens 2 Jahre in der Pflegeversicherung versichert war.
Als pflegebedürftig im Sinne des SGB XI gelten Personen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere benötigen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich mindestens sechs Monate vorliegen. Pflegebedürftigkeit liegt auch dann vor, wenn der personelle Unterstützungsbedarf nur deswegen nicht mindestens 6 Monate lang gegeben ist, weil die zu erwartende Lebensdauer kürzer ist.
Die Pflegebedürftigkeit wird nach den „Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI“ in der jeweils gültigen Fassung beurteilt. Berücksichtigt wird hierbei, dass nicht die Schwere der Erkrankung oder Behinderung, sondern die gesundheitlichen Beeinträchtigungen in der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten als Grundlage der Bestimmung der Pflegebedürftigkeit dient. Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten werden anhand der in den nachfolgenden sechs Modulen genannten pflegefachlich begründeten Kriterien ermittelt:
Je nach Schwere der Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder Fähigkeiten werden Pflegebedürftige einem von fünf Pflegegraden (Pflegegrade 1–5) zugeordnet.
Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit erfolgt grundsätzlich durch den Medizinischen Dienst (MD) im Auftrag der Pflegekassen. Der MD führt hierzu eine Begutachtung durch und gibt anschließend eine Empfehlung zur Zuordnung zu einem Pflegegrad. Die Pflegekasse entscheidet dann über die Zuordnung, die direkte Auswirkungen auf die möglichen Leistungen hat.
In § 15 SGB XI sind die Kriterien zur Ermittlung der Pflegebedürftigkeit im Rahmen des Neuen Begutachtungsassessment (NBA) genannt.
Der Pflegegrad wird mithilfe eines pflegewissenschaftlich begründeten Begutachtungsinstruments in den oben benannten sechs Modulen ermittelt.
„Im Mittelpunkt steht die Beurteilung der Selbständigkeit eines Menschen in sechs Lebensbereichen, die jeden Menschen jeden Tag betreffen. Selbständig ist eine Person, die eine Handlung bzw. Aktivität alleine, d. h. ohne Unterstützung durch andere Personen oder unter Nutzung von Hilfsmitteln durchführen kann. Die Selbständigkeit einer Person bei der Ausführung bestimmter Handlungen bzw. Aktivitäten wird unter der Annahme bewertet, dass sie diese ausführen möchte. Es ist unerheblich, welche Hilfeleistungen tatsächlich erbracht werden.“1
Festgestellt wird die Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten in einer Skala von
0 = selbstständig
1 = überwiegend selbstständig
2 = überwiegend unselbstständig
3 = unselbstständig.
Die sechs Module sind unterschiedlich gewichtet:
Die Module 7 „Außerhäusliche Aktivitäten“ und 8 „Haushaltsführung“ werden mit erhoben, sind aber nicht pflegegradrelevant. Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten, die dazu führen, dass die Haushaltsführung nicht mehr ohne Hilfe bewältigt werden kann, sind bereits in den Modulen 1-6 berücksichtigt. Bestimmte körperliche oder kognitive Beeinträchtigungen, die bereits erfasst worden sind, führen automatisch auch dazu, dass zugleich auch die Fähigkeit zur eigenständigen Haushaltsführung beeinträchtigt ist. Mit den Informationen aus der Erfassung der außerhäuslichen Aktivitäten sollen eine umfassende Pflegeberatung und die Erstellung eines individuellen Versorgungsplanes ermöglicht werden.
In einer Bewertungssystematik werden die Punktwerte der einzelnen Module unter Berücksichtigung der Gewichtung summiert und ergeben den Pflegegrad. Näheres dazu wird in den folgenden Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes beschrieben:
Begutachtungsrichtlinien und Richtlinien zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit (Stand 17.05.2021)
Die Begutachtung der versicherten Pflegebedürftigen Personen, welche die Pflegekassen vom MD oder anderen unabhängigen Gutachtern durchführen lässt, umfasst die Prüfung der Pflegebedürftigkeit nach § 14 SGB XI unter Anwendung des Neuen Begutachtungsinstruments und die Eingraduierung in den entsprechenden Pflegegrad. Die Begutachtung hat im Wohnbereich der hilfebedürftigen Person stattzufinden. Eine Ausnahme kann nur erfolgen, wenn aufgrund eindeutiger Aktenlage das Ergebnis bereits feststeht.
Entsprechend § 142a SGB XI besteht die Möglichkeit der Feststellung von Pflegebedürftigkeit und Einstufung in einen Pflegegrad aufgrund eines strukturierten telefonischen Interviews ergänzend oder alternativ zu einer Untersuchung der versicherten Person in dessen Wohnbereich. Diesbezüglich sind entsprechende pflegewissenschaftliche Studien zugrunde zu legen. Eine Begutachtung aufgrund eines telefonischen Interviews ist ausgeschlossen, wenn
1. es sich um eine erstmalige Untersuchung der antragstellenden Person handelt, in der geprüft wird, ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind und welcher Pflegegrad vorliegt,
2. es sich um eine Untersuchung aufgrund eines Widerspruchs gegen eine Entscheidung der Pflegekasse zum festgestellten Pflegegrad handelt,
3. es sich um eine Prüfung der Pflegebedürftigkeit von Kindern handelt oder
4. die der Begutachtung unmittelbar vorangegangene Begutachtung das Ergebnis enthält, dass Pflegebedürftigkeit nicht vorliegt.
Dem Bundesministerium für Gesundheit ist bis zum 30.06.2024 ein Evaluationsbericht vorzulegen.
Die Pflegekasse leitet die Anträge unverzüglich an den MD oder an den von der Pflegekasse beauftragten Gutachter weiter, der diesen Antrag so bearbeitet, dass die Pflegekasse innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Antragstellung der antragstellenden Person schriftlich eine Entscheidung mitteilen kann. Erteilt die Pflegekasse den Bescheid über den Antrag nicht innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, hat die Pflegekasse nach Fristablauf für jede begonnene Woche der Fristüberüberschreitung unverzüglich 70 € an die antragstellende Person zu zahlen. Dies gilt nicht, wenn die Pflegekasse die Verzögerung nicht zu vertreten hat oder sich die antragstellende Person in vollstationärer Pflege befindet und bereits mindestens dem Pflegegrad 2 zugeordnet worden ist (§ 18 Abs. 3b SGB XI). Verzögerungsgründe, die die Pflegekasse nicht zu vertreten hat, können unter anderem sein:
Diese Regelung (inkl. die Regelung zur Zahlungspflicht) gilt nicht für Wiederholungs- oder Widerspruchsgutachten.
Befindet sich die antragstellende Person im Krankenhaus oder in einer stationären Rehabilitationseinrichtung, ist die Begutachtung unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Antragseingang bei der Pflegekasse durchzuführen, wenn Hinweise darauf bestehen, dass
a) zur Sicherstellung der ambulanten oder stationären Weiterversorgung und Betreuung eine Begutachtung in der Einrichtung erforderlich ist oder
b) die Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz gegenüber der arbeitgebenden Instanz der pflegenden Person angekündigt wurde oder
c) mit der arbeitgebenden Instanz der pflegenden Person eine Familienpflegezeit vereinbart wurde.
Die verkürzte Begutachtungszeit gilt auch dann, wenn die antragstellende Person sich in einem Hospiz befindet oder ambulant palliativ versorgt wird.
Spätestens nach 2 Wochen muss der MD eine Begutachtung durchführen, wenn die antragstellende Person ambulant nicht palliativ gepflegt wird, jedoch eine Pflegezeit im Sinne des Pflegezeitgesetzes gegenüber der arbeitgebenden Instanz der Pflegeperson angekündigt wurde.
Gem. § 18 Abs. 4 SGB XI soll der MD vor der Begutachtung, soweit die hilfebedürftige Person einwilligt, ärztliche Auskünfte der behandelnden Ärzte/Ärztinnen und wichtige Unterlagen (insbesondere über Vorerkrankungen, aber auch zur Information über Art, Umfang und Dauer der Hilfebedürftigkeit) einholen, um diese in die Begutachtung mit einzubeziehen.
Das Gutachten wird der antragstellenden Person durch die Pflegekasse übersandt, sofern diese der Übersendung nicht widerspricht.
Die Pflegekasse ist verpflichtet, der antragstellenden Person die gesonderte Präventions- und Rehabilitationsempfehlung zuzuleiten und hierzu umfassend und begründet Stellung zu nehmen. Stellt die Pflegekasse auf Grundlage der Empfehlungen des MD oder der Person, die das Gutachten erstellt, einen Rehabilitationsbedarf fest und willigt die antragstellende Person in das Verfahren ein, löst dieses ein Antragsverfahren auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation beim zuständigen Rehabilitationsträger aus (§ 18a SGB XI).
Die Feststellungen zur Prävention oder zur medizinischen Rehabilitation sind durch den MD auf der Grundlage eines bundeseinheitlichen strukturierten Verfahrens zu treffen.
Die Empfehlungen des MD zu einer Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung gelten jeweils als Antrag, wenn die Zustimmung erfolgt.
Leistungsberechtigte haben gegenüber ihrer Pflegekasse Anspruch auf eine individuelle Beratung und Hilfestellung durch eine pflegeberatende Person.
Aufgabenschwerpunkte der Pflegeberatung können je nach Bedarf im Einzelfall insbesondere folgende Themen sein:
oder
Die Pflegeberatung soll dazu beitragen, jeder pflegebedürftigen Personen Person eine an ihren persönlichen Bedarf ausgerichtete, qualifizierte Pflege, Betreuung und Behandlung zukommen zu lassen.
Auf Wunsch der anspruchsberechtigten Person erfolgt die Beratung auch gegenüber ihren Angehörigen oder unter deren Einbeziehung sowie in der häuslichen Umgebung oder Einrichtung.
Die Pflegekasse hat der antragstellenden Person unmittelbar nach Eingang eines erstmaligen Antrags auf Leistungen nach dem SGB XI oder des erklärten Bedarfs einer Begutachtung zur Feststellung einer Pflegebedürftigkeit oder weiterer Anträge auf Leistungen nach §§ 36 – 38a, 40 Abs. 1 und 4, den §§ 40b, 41 – 43, 44a, 45, 45e, 87a Abs. 2 S. 1 und § 115 Abs. 4 SGB XI einen konkreten Beratungstermin spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang anzubieten und durchzuführen (§ 7b SGB XI). Ebenfalls haben die Pflegekassen die Möglichkeit, einen Beratungsgutschein auszustellen, der bei einer Beratungsstelle innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang eingelöst werden kann. Auf Wunsch der antragstellenden Person hat die Beratung in der häuslichen Umgebung zu erfolgen.
Die Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Durchführung der Pflegeberatung sind hier zu finden:
Korrespondierend zum Rechtsanspruch auf Pflegeberatung wurden Pflegestützpunkte gem. § 7c SGB XI geschaffen. Die Kernaufgaben der Pflegestützpunkte sind die Beratung und Begleitung der pflegebedürftigen Personen Person und ihrer Angehörigen. Die Pflegestützpunkte im Land Bremen sind von den Pflegekassen in Kooperation mit dem Land Bremen und den Kommunen Bremen und Bremerhaven errichtet worden. Die Pflegestützpunkte sind so konzipiert, dass eine neutrale, unabhängige und kostenlose Beratung jederzeit gewährleistet ist. Die pflegeberatenden Personen haben auch eine Koordinierungsfunktion und betreiben ein sogenanntes Case-Management, d. h. sie erstellen Versorgungspläne, die auf Wunsch den antragstellenden Personen zur Verfügung gestellt werden.
Die Beeinträchtigungen von Personen im Pflegegrad 1 (PG 1) sind gering und liegen vorrangig im somatischen Bereich. Sie erfordern Teilhilfen bei der Selbstversorgung, beim Verlassen der Wohnung und bei der Haushaltsführung. Daneben sind beratende Unterstützungsangebote von Bedeutung. Insgesamt stehen Leistungen im Vordergrund, die den Verbleib in der häuslichen Umgebung sicherstellen, ohne dass bereits voller Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung angezeigt ist. Dies gilt insbesondere für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1, die alleine leben, aber auch für diejenigen, deren soziales Umfeld die erforderlichen Unterstützungsleistungen nicht erbringen kann oder will.
Damit Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 die ihnen zustehenden Ansprüche leicht finden und realisieren können und somit möglichst selbständig in der gewohnten häuslichen Umgebung verbleiben können, gibt § 28a einen Überblick über die Leistungen, die für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 gewährt werden.
Im Einzelnen sind die Leistungen bei Pflegegrad 1 gem. § 28a SGB XI abschließend aufgeführt:
Der Gesetzgeber gibt für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 keinen Raum für weitere Leistungen.
Ab einem Pflegegrad 2 (PG 2-5) besteht der Anspruch auf die gesamten möglichen Leistungen der Pflegeversicherung. Diese werden in § 28 SGB XI aufgeführt:
Um die Pflege (körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung) im eigenen Wohnraum sicherzustellen, haben Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 die Möglichkeit, bei der Pflegekasse Pflegesachleistungen, ein Pflegegeld oder Kombinationsleistungen in Anspruch zu nehmen.
Hinsichtlich der Inanspruchnahme der Leistungen besteht ein Wahlrecht zwischen ausschließlich Pflegesachleistungen (§ 36 SGB XI), ausschließlich Pflegegeld (§ 37 SGB XI) und Kombinationsleistungen (§ 38 SGB XI).
Die körperbezogenen Pflegemaßnahmen beziehen sich insbesondere auf die Bereiche Mobilität und Selbstversorgung. Sie umfassen
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen umfassen Unterstützungsleistungen zur Bewältigung und Gestaltung des alltäglichen Lebens im häuslichen Umfeld und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche kognitiver und kommunikativer Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychischer Problemlagen sowie auf die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Sie umfassen Unterstützungsleistungen zur Bewältigung psychosozialer Problemlagen oder Gefährdungen (Selbst- oder Fremdgefährdung), bei der Orientierung, bei der Tagesstruktur, Kommunikation, Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, kognitiver Aktivierung sowie bei der bedürfnisgerechten Beschäftigung im Alltag. Die Maßnahmen beziehen sich nicht auf die Unterstützung des Besuchs von Kindergarten, Schule, der Berufstätigkeit oder der Ausübung von Ämtern.
Sie umfassen gezielt
Hilfe bei der Haushaltsführung umfasst die in § 18 Abs. 5a SGB XI erfassten Aktivitäten. Die Hilfe bei der Haushaltsführung umfasst
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2-5 haben bei häuslicher Pflege als Pflegesachleistung gem. § 36 SGB XI einen Anspruch auf körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie auf Hilfen bei der Haushaltsführung. Häusliche Pflege im Rahmen der Pflegesachleistung wird durch geeignete Pflegekräfte oder über ambulante Pflegedienste erbracht, die mit den Pflegekassen einen Versorgungsvertrag abgeschlossen haben. Für die pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung können auch ambulante Betreuungsdienste nach § 71 Abs. 1a SGB XI tätig werden.
Der Anspruch umfasst pflegerische Maßnahmen in den nach § 14 SGB XI genannten Bereichen (Modulen). Sie umfasst auch die pflegerische Anleitung von Pflegebedürftigen Personen und Pflegepersonen.
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen umfassen die in § 36 Abs. 2 SGB XI genannten Unterstützungsleistungen, die keine abschließende Aufzählung darstellt.
Der Anspruch auf häusliche Pflege ist ausgeschlossen, wenn die pflegebedürftige Person Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43 SGB XI bezieht. Darüber hinaus besteht kein Anspruch auf häusliche Pflege, wenn die pflegebedürftige Person beispielsweise im Krankenhaus, einer Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung oder in einem Wohnheim für behinderte Menschen versorgt wird.
Die Pflegesachleistungen werden monatlich pauschaliert bis zu folgenden Leistungshöhen gewährt:
für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 2 |
| bis zu 761,00 € |
für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 3 | bis zu 1.432,00 € | |
für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 4 | bis zu 1.778,00 € | |
für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 5 | bis zu 2.200,00 €. |
Investitionskosten werden von der Pflegekasse nicht übernommen. Zu den Übernahmemöglichkeiten im Kontext der Hilfe zur Pflege s. Berücksichtigungsfähige Kosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege
Mehrere Pflegebedürftige, die in enger räumlicher Nähe leben, können körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung gemeinsam abrufen. Dadurch können Vorteile im Bereich der Zeit- oder Kosteneinsparungen genutzt werden.
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2-5 haben einen Anspruch auf Pflegegeld gem. § 37 SGB XI, sofern die Pflege in häuslicher Umgebung in geeigneter Weise selbst sicherstellt wird. Die selbst sicherzustellende Pflege bezieht sich auf die erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen, pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung. Unbeachtlich ist, ob die Pflege durch Angehörige, der in Partnerschaft lebenden Person, sonstige ehrenamtliche Pflegepersonen, erwerbsmäßige Pflegekräfte oder angestellte Pflegepersonen erbracht wird.
Kann die Pflege nicht in geeigneter Weise selbst sichergestellt werden - z. B. nach einer Feststellung des MD nach § 18 Abs. 6 Satz 4 SGB XI –, kann das Pflegegeld nicht gezahlt werden. Mit dem Pflegegeld soll die pflegebedürftige Person in die Lage versetzt werden, Angehörigen, der in Partnerschaft lebenden Person und sonstigen Pflegepersonen eine materielle Anerkennung für die im häuslichen Bereich erbrachte Pflege und Betreuung zukommen zu lassen.
Der Anspruch auf das Pflegegeld ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die pflegebedürftige Person vollstationäre Leistungen im Sinne von § 43 SGB XI bezieht.
Die Höhe des Pflegegeldes ist abhängig vom Pflegegrad.
Das Pflegegeld wird bis zum Ende des Kalendermonats gezahlt, in dem die pflegebedürftige Person verstorben ist.
Der Anspruch auf Pflegegeld ruht nach § 34 Abs. 2 SGB XI wenn der Anspruch auf häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V besteht und diese auch Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung umfasst. Der Anspruch ruht weiter bei einem stationären Aufenthalt im Sinne des § 71 Abs. 4 SGB XI (dies betrifft u. a. einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus oder innerhalb von Einrichtungen, in denen Leistungen zur medizinischen Vorsorge und Rehabilitation erbracht werden).
Das Pflegegeld nach § 37 SGB XI oder anteilige Pflegegeld aus Kombinationsleistungen nach § 38 SGB XI ist in den ersten vier Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung, einer häuslichen Krankenpflege mit einem Anspruch auf Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung oder einer stationären Leistung zur medizinischen Rehabilitation weiter zu zahlen. Die Weiterzahlung des Pflegegeldes während eines vollstationären Krankenhausaufenthaltes setzt voraus, dass vor dem Krankenhausaufenthalt bereits ein Anspruch auf Pflegegeld bestand. Wird während des Krankenhausaufenthaltes Pflegegeld beantragt, setzt dieses erst mit dem Tag ein, an dem die pflegebedürftige Person sich wieder in seiner häuslichen Umgebung befindet.
In Fällen der Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI und der Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI wird die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes jeweils für bis zu acht Wochen bei der Kurzzeitpflege und 6 Wochen bei der Verhinderungspflege weitergezahlt. Voraussetzung ist auch an dieser Stelle, dass ein Anspruch auf Pflegegeld bereits vor Beginn der Maßnahme bestand.
Werden Leistungen der Verhinderungspflege in eigener Häuslichkeit durch nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen erbracht, die bis zum Zweiten Grade mit der pflegebedürftigen Personen Person verwandt oder verschwägert sind, wird das hälftige Pflegegeld zusätzlich zu den Aufwendungen in Höhe des Pflegegeldes weitergezahlt (= 1,5fache des Pflegegeldes).
Durch das Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus vom 30.07.2009 wird für pflegebedürftige Menschen, die ihre Pflege durch von ihnen selbst beschäftige Pflegekräfte sicherstellen und bei denen § 63b Abs. 6 Satz 1 SGB XII (Arbeitgebermodell) Anwendung findet, das Pflegegeld auch über die ersten vier Wochen hinaus gezahlt.
Das Pflegegeld beträgt je Kalendermonat: |
| |
für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 2 | 332,00 € | |
für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 3 | 573,00 € | |
für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 4 | 765,00 € | |
für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 5 | 947,00 €. |
Kombinationsleistung, auch Kombinationspflege oder Kombipflege genannt, meint in der Pflege die Kombination aus Pflegesachleistungen und Pflegegeld. Wird die Pflegesachleistung nach § 36 SGB XI nur teilweise in Anspruch genommen, wird ein anteiliges restliches Pflegegeld nach § 37 SGB XI geleistet (Kombinationsleistung gem. § 38 SGB XI). Die Kombinationsleistung soll dabei helfen, die Pflege auf die individuellen Bedürfnisse der pflegebedürftigen Personen Person abzustimmen.
Die Höhe des restlichen Pflegegeldes richtet sich nach dem Pflegegrad und der prozentual in Anspruch genommenen Pflegesachleistung. Der Anspruch auf das restliche Pflegegeld verringert sich somit um den Prozentsatz der ausgeschöpften Pflegesachleistung. Je mehr Ausgaben es also für genutzte Pflegesachleistungen gibt, desto geringer ist das restliche Pflegegeld.
Beispiel: | |
In Anspruch genommene Pflegesachleistung: | 80% des jeweiligen Pflegegrades |
Gewährung eines restlichen Pflegegeldes: | 20 % des jeweiligen Pflegegrades |
Die Höhe des zu gewährenden restlichen Pflegegeldes kann von Monat zu Monat je nach Höhe der in Anspruch genommenen Pflegesachleistungen variieren.
Bei Bezug eines Pflegegeldes besteht für die pflegebedürftige Person die Verpflichtung bei Pflegegrad 2 und 3 einmal halbjährlich und bei Pflegegrad 4 und 5 einmal vierteljährlich eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit eine pflegeberatende Person zu beauftragen (§ 37 Abs. 3 SGB XI).
Die Beratung soll der Qualitätssicherung der häuslichen Pflege und der regelmäßigen pflegefachlichen Unterstützung der häuslich pflegenden Personen dienen. Die Beratungskosten werden von der zuständigen Pflegekasse bzw. dem privaten Versicherungsunternehmen getragen.
Die Prüfungen beinhalten die Inaugenscheinnahme des gesundheitlichen und pflegerischen Zustands die pflegebedürftige Person sowie die Befragung von Angehörigen und Betreuungspersonen.
Rufen Pflegebedürftige die Beratung nicht ab, kann das Pflegegeld seitens der Pflegeversicherung gekürzt oder entzogen werden.
Leistungsberechtigt sind Pflegebedürftige der Pflegegrade 2-5, die ihre Pflege durch Gewährung eines Pflegegeldes über Pflegepersonen (Angehörige, der in Partnerschaft lebenden Person, Nachbarn, Bekannte oder sonstige Personen, die die pflegebedürftige Person nicht erwerbsmäßig in der Häuslichkeit pflegen) sicherstellen. Voraussetzung für die Gewährung der Verhinderungspflege ist, dass die Pflegeperson wegen Urlaub, Krankheit oder aus sonstigen Gründen an der Pflege gehindert ist.
Die Pflegekasse kann die Kosten für eine Ersatzpflege oder Verhinderungspflege gem. § 39 SGB XI für längstens 8 Wochen im Kalenderjahr bis zu einem Höchstbetrag von 1.612,00 € übernehmen. Ergänzend kann der Leistungsbetrag um bis zu 1.774,00 € aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege erhöht werden.
Im Rahmen der Verhinderungspflege ist zwischen einer nicht erwerbsmäßigen (Ersatzpflege durch Pflegeperson) und einer erwerbsmäßigen Verhinderungspflege (z. B. durch einen Pflegedienst) zu unterscheiden.
Bei einer Ersatzpflege durch Pflegepersonen, die mit dem Pflegebedürftigen Personen bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, sind die Aufwendungen der Pflegekasse grundsätzlich auf die Höhe des 1,5-fachen Pflegegeldbetrages nach 37 Abs. 1 SGB XI für bis zu 8 Wochen beschränkt.
Bei einer stundenweisen Leistungserbringung ist auch eine Inanspruchnahme von Verhinderungspflege möglich.
Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von der Pflegekasse nicht übernommen. Zu den Übernahmemöglichkeiten im Kontext der Hilfe zur Pflege s. Berücksichtigungsfähige Kosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege
Durch das „Gesetz über die Pflegezeit“ wird geregelt, dass sofern im Zusammenhang mit den arbeitsrechtlichen Ansprüchen beschäftigter Personen auf Freistellung von der Arbeitsleistung für die Pflege eines pflegebedürftigen Personen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung oder Entgeltersatzzahlung besteht, der Verdienstausfall unter bestimmten Voraussetzungen als Aufwand der Verhinderungspflege im Sinne des § 39 Abs. 2 SGB XI berücksichtigt werden kann. Dies gilt nicht, wenn die Verhinderungspflege im Zusammenhang mit einer kurzfristigen Arbeitsverhinderung im Umfang von bis zu 10 Arbeitstagen erbracht wird und die Ersatzpflegeperson ein Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a SGB XI als Ausgleich für entgangenes Arbeitsentgelt erhält.
Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 haben Anspruch auf die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, die zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden führen oder eine selbstständige Lebensführung ermöglichen.
Zu unterscheiden sind:
Die Leistungen sind in einem Pflegehilfsmittelverzeichnis gem. § 78 SGB XI zusammengefasst. Diese wird von den Spitzenverbänden der Krankenkassen regelmäßig veröffentlicht.
Die Gewährung von Pflegehilfsmitteln erfolgt auf Antragstellung. Vor einer Bewilligung kann die Pflegekasse die Notwendigkeit der Versorgung unter Beteiligung einer Pflegefachkraft oder des MD überprüfen lassen.
Aufwendungen für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmitteln werden bis zu 40,00 € monatlich übernommen. Technische Pflegehilfsmittel sollen vorrangig leihweise zur Verfügung gestellt werden.
Für die monatliche Grundgebühr eines Hausnotrufsystems werden 25,50 € seitens der Pflegeversicherung übernommen.
Der MD gibt im Rahmen der Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit konkrete Empfehlungen zur Versorgung von Hilfs- oder Pflegehilfsmitteln ab. Die Empfehlungen gelten als Antrag, sofern die pflegebedürftige Person dem zustimmt. Die Notwendigkeit der Versorgung mit dem Pflegehilfsmittel wird vermutet.
Auch für sogenannte doppelfunktionale Hilfsmittel/Pflegehilfsmittel gibt der MD im Rahmen der Begutachtung Empfehlungen ab. Doppelfunktionale Hilfsmittel sind Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel, die sowohl den in §§ 23 und 33 SGB V als auch den in § 40 Abs. 1 SGB XI genannten Zwecken dienen können (§ 40 Abs. 5 Satz 1 SGB V). Für diese Hilfsmittel gelten die Empfehlungen als Antrag bei den Kassen, sofern die antragstellende Person zustimmt. Die Notwendigkeit und Erforderlichkeit des empfohlenen Hilfsmittels wird dann nach dem SGB XI und SGB V vermutet. Es bedarf dann keiner ärztlichen Verordnung mehr. Zu den doppelfunktionalen Hilfsmitteln gehören z. B. Rollstühle, Pflegebetten, Badewannensitze, Umsetz- und Hebehilfen und Toilettensitze.
Auch Pflegefachkräfte können im Rahmen ihrer Leistungserbringung nach §§ 36 ff SGB XI sowie der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung abgeben. Die Empfehlung ist zusammen mit dem Antrag der pflegebedürftigen Personen Person in Textform an die Pflegekasse zu übermitteln. Die Notwendigkeit der Versorgung mit dem Pflegehilfsmittel wird vermutet. Der GKV-Spitzenverband legt fest, in welchen Fällen und für welche Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel die Notwendigkeit der Versorgung vermutet wird. Auch regelt die Richtlinie, über welche Eignung die empfehlende Pflegefachkraft verfügen muss.
Die zu diesen Regelungen gehörenden Richtlinien sind hier einsehbar:
Richtlinien zur Empfehlung von Hilfsmitteln durch Pflegefachkräfte (GKV-Spitzenverband)
Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes
Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Festlegung der doppelfunktionalen Hilfsmittel vom 24.06.2020
Nach § 40 SGB XI können für Pflegebedürftige ab PG 1 auch Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes wie zum Beispiel Türverbreiterungen oder den behindertengerechten Umbau von Sanitäranlagen im Rahmen einer Zuschussbewilligung gewährt werden.
Voraussetzungen für die Bewilligung des Zuschusses durch die Pflegekasse ist, dass die häusliche Pflege durch die Maßnahme ermöglicht oder erleichtert, bzw. eine möglichst selbständige Lebensführung der pflegebedürftigen Personen Person wiederhergestellt wird.
Die Pflegekassen können je (Gesamt-)Maßnahme bis zu einem Betrag von 4.000,00 € an Zuschuss gewähren.
Eine Maßnahme zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes der pflegebedürftigen Personen Person liegt auch vor, wenn eine Verbesserung durch einen Umzug in eine den Anforderungen der pflegebedürftigen Personen Person entsprechende Wohnung erreicht werden kann. In diesem Fall kann die Pflegekasse nach den Besonderheiten des Einzelfalles die Umzugskosten bezuschussen.
Digitale Pflegeanwendungen können in der Häuslichkeit die Pflege sowie die pflegerische Betreuung unterstützen und entsprechen damit dem Vorrang der häuslichen Pflege. Digitale Pflegeanwendungen bestehen in vorrangig software- oder webbasierten Versorgungsangeboten, die anleitend begleiten, um Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten der pflegebedürftigen Personen Person zu mindern und einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit entgegenzuwirken.
Der Anspruch auf digitale Pflegeanwendungen umfasst nur solche, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in das Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen nach § 78 Abs. 3 SGB XI aufgenommen sind.
Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 haben gem. § 39a SGB XI einen Anspruch auf ergänzende Unterstützungsleistungen durch zugelassene ambulante Pflegedienste, wenn diese bei der Versorgung mit einer digitalen Pflegeanwendung im Einzelfall erforderlich ist. Die ergänzende Unterstützung kann eine erste Hilfe beim Einsatz der digitalen Pflegeanwendung umfassen, sofern die Anleitung nicht dem Hersteller obliegt.
Einzelheiten zum Anspruch auf ergänzende Unterstützungsleistungen werden durch das BfArM im Rahmen des zu errichtende Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen erfasst (§ 78a Abs. 3 SGB XI).
Bei bestehender Notwendigkeit der Versorgung mit einer digitalen Pflegeanwendung und nach Antragstellung können seitens der Pflegeversicherung bis zu insgesamt 50,00 € monatlich für digitale Pflegeaufwendungen und ergänzende Unterstützungsleistungen gewährt werden.
Das Verzeichnis der digitalen Pflegeanwendungen ist Stand 07/2023 noch nicht veröffentlicht.
Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 haben einen Anspruch auf niedrigschwellige Angebote zur Unterstützung im Alltag. Ziel dieser Angebote ist es, Pflegepersonen zu entlasten und Pflegebedürftigen Personen dabei zu helfen, möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und ihren Alltag möglichst selbstständig bewältigen zu können. Je nach Ausrichtung des Angebotes kann es sich dabei um Betreuungsangebote für die pflegebedürftige Person, Angebote zur Entlastung von Pflegepersonen oder um Angebote zur Entlastung im Alltag handeln. Sie beinhalten die Übernahme von Betreuung und allgemeiner Beaufsichtigung, eine stärkende oder stabilisierende Alltagsbegleitung, Unterstützungsleistungen für Pflegepersonen, Erbringung von Dienstleistungen, organisatorische Hilfestellungen oder andere geeignete Maßnahmen.
Zu den Angeboten zählen insbesondere:
Voraussetzung für die Leistungserbringung ist, dass es sich um geförderte, bzw. förderungsfähige Angebote nach § 45c SGB XI handelt. Die Anerkennung durch die zuständige Behörde ist notwendig.
Das Nähere regelt eine Rechtverordnung des Landes. Die Verordnungsermächtigung der Landesregierungen ergibt sich aus § 45a Abs. 3 SGB XI.
Eine Übersicht über die Angebote zur Unterstützung im Alltag einschließlich der von ihnen angebotenen Leistungen inkl. Kosten wird regelmäßig im Internet veröffentlicht.
Schöpft die pflegebedürftige Person mit PG 2-5 den ihr zustehenden Sachleistungsbetrag gem. § 36 SGB XI nicht voll aus, kann sie den nicht verwendeten Betrag für die Erstattung der Aufwendungen für Angebote zur Unterstützung im Alltag gem. § 45a SGB XI verwenden. Der höchstmögliche Umwandlungsanspruch beträgt maximal 40 % der jeweiligen Pflegesachleistung. Für die Nutzung des Umwandlungsanspruchs bedarf es keiner vorherigen Antragstellung.
Anspruchsberechtigt sind Pflegebedürftige, die
Für die Berechnung des anteiligen Pflegegeldes bei Bezug von Kombinationsleistungen gilt der verwendete Leistungsbetrag für die Angebote zur Unterstützung im Alltag als Inanspruchnahme der Pflegesachleistung.
Bei Bezug eines ausschließlichen Pflegegeldes gilt der verwendete Leistungsbetrag für die Angebote zur Unterstützung im Alltag als Inanspruchnahme der Pflegesachleistung mit dem Ergebnis, dass für die Berechnung des anteiligen Pflegegeldes die Kombinationsregelung nach § 38 SGB XI entsprechend anzuwenden ist.
Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 in häuslicher Pflege haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 € monatlich.
Der Entlastungsbetrag dient der Erstattung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme
Gem. § 45b Abs. 2 SGB XI können Leistungen, die in einem Kalenderjahr von der versicherten Person nicht in Anspruch genommen wurden, auf das nächste Kalenderhalbjahr übertragen werden. Wird der auf das folgende Kalenderhalbjahr übertragene Leistungsanspruch nicht ausgeschöpft, verfällt dieser.
Pflegebedürftige der Pflegegrade 1-5 in ambulant betreuten Wohngruppen haben neben dem Anspruch auf Leistungen nach den §§ 36 bis 38 SGB XI gem. § 38a SGB XI oder bei Inanspruchnahme von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI oder den Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI zusätzlich einen Anspruch auf einen pauschalen „Wohngruppenzuschlag“ in Höhe von pauschal 214 €.
Mit dem Wohngruppenzuschlag sollen die zusätzlichen Aufwendungen der Wohngruppe für die nach § 38a Abs. 1 Nr. 3 SGB XI gemeinschaftlich beauftragte Person finanziert werden, die allgemeine organisatorische, verwaltende, betreuende oder das Gemeinschaftsleben fördernde Tätigkeiten verrichtet oder hauswirtschaftliche Unterstützung leistet.
Die Zahlung der Leistung setzt voraus, dass mindestens drei und höchstens 12 pflegebedürftige Personen in einer gemeinsamen Wohnung zum Zweck der gemeinschaftlich organisierten pflegerischen Versorgung zusammenleben. Das Zusammenleben innerhalb eines Familienverbandes verfolgt diesen Zweck der gemeinschaftlichen pflegerischen Versorgung nach dem Willen des Gesetzgebers nicht.
Bei der im Sinne von § 38a Abs. 1 Nr. 3 SGB XI beauftragten Person muss es sich um eine ausgebildete Pflegefachkraft handeln. Die Dauer der Tätigkeit der beauftragten Person ist nicht beschrieben, eine Rufbereitschaft ist allerdings nicht ausreichend.
Der Anspruch setzt voraus, dass die freie Wählbarkeit der Pflege- und Betreuungsleistungen rechtlich und tatsächlich nicht eingeschränkt sind. Um eine ambulant betreute Wohngruppe handelt es sich nicht, wenn eine Versorgungsform vorliegt, in denen Leistungen angeboten bzw. gewährleistet werden, die denen im Rahmenvertrag für die vollstationäre Pflege vereinbarten Leistungsumfang entsprechen.
Voraussetzung für eine Gewährung dieser Leistungsform ist, dass die häusliche Pflege nicht ausreichend sicherzustellen oder die Tages- und Nachtpflege gem. § 41 SGB XI als teilstationäres Angebot zur Ergänzung und Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Dies gilt insbesondere in den Fällen
Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen, Kosten der sozialen Betreuung und die Fahrtkosten je Kalendermonat bis zu der in § 41 Abs. 2 SGB XI je nach Pflegegrad benannten Höhe:
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 2 | bis zu 689,00 € |
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 3 | bis zu 1.298,00 € |
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 4 | bis zu 1.612,00 € |
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 5 | bis zu 1.995,00 €. |
Die Leistungen der Tages- und Nachtpflege können zusätzlich zu den Leistungen der Pflegesachleistung, des Pflegegeldes oder der Kombinationsleistung in Anspruch genommen werden, ohne dass eine Anrechnung erfolgt. Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von der Pflegekasse nicht übernommen. Zu den Übernahmemöglichkeiten im Kontext der Hilfe zur Pflege s. Berücksichtigungsfähige Kosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege.
Die Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege haben eine wichtige Funktion bei der Entlastung pflegender Angehöriger. Sie sind unter aktivierenden Gesichtspunkten bei der Versorgung und Betreuung von demenziell erkrankten Menschen von großer Bedeutung. Die teilstationäre Pflege dient daher der Ergänzung und Stärkung der häuslichen Pflege.
Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Tages- und Nachtpflege gem. § 41 SGB XI kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die Notwendigkeit durch den MD überprüft ist.
Voraussetzung für die Gewährung einer Kurzzeitpflege als stationäres Angebot gem. § 42 SGB XI ist, dass die häusliche Pflege nicht im erforderlichen Umfang sichergestellt werden kann und auch eine teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) nicht ausreichend ist. In Betracht kommt die Kurzzeitpflege für eine Übergangszeit im Anschluss an eine stationäre Behandlung der pflegebedürftigen Personen Person oder in sonstigen Krisensituationen, in denen vorübergehend häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder nicht ausreichend ist.
Die Leistung nach dem SGB XI ist auf acht Wochen im Kalenderjahr begrenzt und umfasst pflegebedingte Aufwendungen und die Kosten der sozialen Betreuung bis zu einem Höchstbetrag von 1.774,00 €. Der Leistungsbetrag kann um bis zu 1.612 € aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege erhöht werden.
Die Pflegekassen im Lande Bremen übernehmen Leistungen der Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI:
Sofern für Anspruchsberechtigte keine geeigneten Kurzzeitpflegeeinrichtungen vorhanden sind, kann gem. § 42 Abs. 3 SGB XI die Kurzzeitpflege auch in geeigneten Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen oder anderen geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. Gem. § 42 Abs. 4 SGB XI besteht auch ein Anspruch auf Kurzzeitpflege, wenn eine gleichzeitige Unterbringung der pflegebedürftigen Personen Person in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung notwendig ist, weil die Pflegeperson dort eine Maßnahme der medizinischen Rehabilitation durchführt.
Insbesondere wenn eine Pflegebedürftigkeit noch nicht festgestellt worden ist, kann es bei einem Übergang aus einer stationären Behandlung in einem Krankenhaus oder einer stationären Rehabilitationseinrichtung in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung zu Problemen kommen. In diesen Fällen ist durch den MD unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Eingang des Antrages eine Begutachtung durchzuführen. Sollte keine Pflegebedürftigkeit mit mindestens Pflegegrad 2 festgestellt werden, kann ein Anspruch auf Kurzzeitpflege nach § 39c SGB V bestehen.
Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von der Pflegekasse nicht übernommen. Zu den Übernahmemöglichkeiten im Kontext der Hilfe zur Pflege s. Berücksichtigungsfähige Kosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege.
Seit dem 01.07.2021 besteht ein Anspruch auf Übergangspflege im Krankenhaus, wenn nach Abschluss der medizinischen Behandlung im Krankenhaus die Versorgung nicht anders sichergestellt werden kann (§ 39e SGB V). Dies betrifft auch die Fälle, deren Versorgung beispielsweise im Rahmen einer Kurzzeitpflege oder durch andere Leistungen nach dem SGB XI nicht sichergestellt werden kann. In diesen Situationen erbringt die Krankenkasse Leistungen der Übergangspflege im Krankenhaus für längstens 10 Tage je Krankenhausbehandlung. Voraussetzung ist, dass die vorherige Krankenhausbehandlung abgeschlossen ist. Die Übergangspflege umfasst die Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, die Aktivierung des Versicherten, die Grund- und Behandlungspflege, ein Entlassmangagement, Unterkunft und Verpflegung sowie die im Einzelfall erforderliche Behandlung.
Es muss eine Vergütungsvereinbarung im Sinne von § 132m SGB V vorliegen, um den Anspruch umsetzen zu können.
Grundsätzlich ist die häusliche bzw. teilstationäre Pflege als dem Grunde nach vorrangig anzusehen. Allerdings besteht seit dem 01.01.2017 ein Anspruch auf vollstationäre Pflege für Pflegebedürftige ab PG 2 unabhängig davon, ob häusliche oder teilstationäre Pflege möglich ist. Es erfolgt keine Prüfung zur Erforderlichkeit der vollstationären Pflege.
Die Pflegekassen erbringen die Leistungen in vollstationären Einrichtungen gem. § 43 Abs. 2 SGB XI in je nach Pflegegrad pauschalierter Höhe. Die Leistungen umfassen die pflegebedingten Aufwendungen, die Aufwendungen der sozialen Betreuung und die Aufwendungen der medizinischen Behandlungspflege. Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von der Pflegekasse grundsätzlich nicht übernommen. Zu den Übernahmemöglichkeiten im Kontext der Hilfe zur Pflege s. Berücksichtigungsfähige Kosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege.
Der Anspruch beträgt je Kalendermonat: | ||
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 2 | 770,00 € |
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 3 | 1.262,00 € |
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 4 | 1.775,00 € |
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 5 | 2.005,00 €. |
Wählen pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 1 vollstationäre Pflege, wird ein Zuschuss (nicht zu verwechseln mit dem Entlastungsbetrag) von 125,00 € monatlich gewährt.
Bei vorübergehender Abwesenheit von pflegebedürftigen Personen aus dem Pflegeheim werden gem. § 43 Abs. 5 SGB XI die Leistungen der vollstationären Pflege erbracht, solange die Voraussetzungen des § 87a Abs. 1 Satz 5 und 6 SGB XI vorliegen (siehe hierzu Abwesenheitsregelung in Teil 4 der Weisung).
Um eine finanzielle Überforderung der vollstationär versorgten pflegebedürftigen Personen in den Pflegegraden 2-5 zu vermeiden, wird der von den pflegebedürftigen Personen zu tragende Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen (einrichtungseinheitlicher Eigenanteil) einschließlich der Ausbildungsumlagen mit zunehmender Dauer der vollstationären Pflege schrittweise reduziert. Ab dem 01.01.2022 reduziert sich dieser Eigenanteil erstmalig in Abhängigkeit der Dauer des Bezugs von Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43 SGB XI durch einen von der Pflegekasse zu zahlenden Leistungszuschlag.
Ein Antrag seitens der pflegebedürftigen Person auf Gewährung des Leistungszuschlags ist nicht notwendig. Die Zahlung des Leistungszuschlags erfolgt an die Pflegeeinrichtung (§ 87a Abs. 3 SGB XI).
Pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 1 haben keinen Anspruch auf den Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI.
Pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 2-5 erhalten einen Leistungszuschlag des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen in Höhe von:
Für die Ermittlung der Dauer des Bezugs von Leistungen nach § 43 SGB XI werden alle Zeiten berücksichtigt, in denen die Leistungen nach § 43 SGB XI bezogen wurden. Bei der Berechnung des Leistungszuschlags bleiben die Kosten für die Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten unberücksichtigt.
Für pflegebedürftige Personen der PG 2-5 in einer vollstationären Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 1 SGB XI, in der die Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder die soziale Teilhabe, die schulische Ausbildung oder die Erziehung von Menschen mit Behinderungen im Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen, übernehmen die Pflegekassen bis zu 266,00 € monatlich zur Abgeltung der pflegebedingten Aufwendungen. Diese Regelung bezieht sich auch auf pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 2–5 in Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 3, die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erhalten.
Wird für die Tage, an denen die pflegebedürftige Person zu Hause gepflegt und betreut wird, anteiliges Pflegegeld beansprucht, so gelten gem. § 43a Satz 4 SGB XI die Tage der An- und Abreise als volle Tage der häuslichen Pflege.
Pflegebedürftige Personen ab Pflegegrad 1 in stationären Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Einrichtungen) haben einen Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung. Zugelassene stationäre Pflegeeinrichtungen erhalten zur Erbringung der Leistungen einen Vergütungszuschlag.
Aufgabe der zusätzlichen Betreuungskräfte ist es, der pflegebedürftigen Person mehr Zuwendung, zusätzliche Betreuung und Aktivierung entgegenzubringen, einen besseren Austausch und im gewissen Maße auch mehr Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
Diese Aufgaben erfolgen praktisch meist innerhalb von Gruppen innerhalb von Alltagsaktivitäten wie malen, lesen, spazieren gehen, Musik hören, kochen, Brettspiele spielen o. ä.
Die gesetzlichen Pflegekassen sowie die privaten Pflegeversicherungsunternehmen zahlen für Pflegepersonen im Sinne des § 19 SGB XI, welche mindestens 10 Stunden wöchentlich nicht erwerbsmäßig in der Häuslichkeit der pflegebedürftigen Personen ab PG 2 die Pflege sicherstellen, Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung. Damit einher geht, dass die Pflegeperson nicht mehr als 30 Stunden in der Woche berufstätig ist. Näheres regeln die §§ 3, 137, 166 und 170 SGB VI. Der MD stellt im Einzelfall fest, ob und in welchem zeitlichen Umfang häusliche Pflege durch eine Pflegeperson erforderlich ist.
Pflegepersonen sind während der pflegerischen Tätigkeit in den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen (§ 44 Abs. 2a SGB XI) und nach dem Recht der Arbeitsförderung versichert. Die Pflegekassen entrichten Beiträge an die Agentur für Arbeit (§ 44 Abs. 2b SGB XI).
Nach dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf können ergänzend folgende Leistungen in Anspruch genommen werden:
Auf ein zinsloses Darlehen durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben besteht ein Rechtsanspruch.
Seit dem 1.7.2004 können pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen an dem trägerübergreifenden Persönlichen Budget gem. § 35a SGB XI teilnehmen. Die Leistungen der Pflegeversicherung können dabei lediglich als Ergänzung eines Persönlichen Budgets in Verantwortung eines Rehabilitationsträgers dienen. Die Teilnahme bezieht sich auf die Leistungen der Pflegesachleistung nach § 36 SGB XI, des Pflegegeldes nach § 37 SGB XI, der Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI – hier ist nur das anteilige und im Voraus bestimmte Pflegegeld budgetfähig -, der zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel nach § 40 Abs. 2 SGB XI und der Kosten für Tages- und Nachtpflege nach § 41 SGB XI. Die Sachleistungen nach den §§ 36, 38 und 41 SGB XI dürfen nur in Form von Gutscheinen zur Verfügung gestellt werden, die zur Inanspruchnahme von zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des SGB XI berechtigen.
Der Begriff der Pflegebedürftigkeit ist in § 61a SGB XII gleichlautend wie im SGB XI beschrieben.
Als pflegebedürftig im Sinne des SGB XII gelten Personen, die gesundheitliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere benötigen. Als pflegebedürftig gilt, bei wem mindestens geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten festgestellt wurden (ab Pflegegrad 1).
Die Leistungsberechtigung im SGB XII ist in einem Punkt im Vergleich zum SGB XI erweitert. Leistungsberechtigt nach dem SGB XII sind auch Personen, die nicht dauerhaft pflegebedürftig sind (also die voraussichtlich für weniger als sechs Monate der Pflege bedürfen).
Einen möglichen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII können folgende Personengruppen haben:
Die Voraussetzungen im SGB XI sind im ersten Teil dieser Verwaltungsanweisung beschrieben: Leistungsberechtigung im SGB XI.
Die Leistungen der Hilfe zur Pflege unterliegen den allgemeinen sozialhilferechtlichen Grundsätzen. Damit hat nicht nur der allgemeine Nachranggrundsatz gem. § 2 SGB XII auch für die Hilfe zur Pflege Bedeutung, sondern insbesondere auch der Individualisierungsgrundsatz sowie das Bedarfsdeckungsprinzip gem. § 9 SGB XII. Die persönliche Situation jeder einzelnen Person ist bei der Gewährung von Leistungen der Hilfe zur Pflege zu berücksichtigen, die konkrete Not- und Bedarfslage steht dabei im Vordergrund. Als Bedarf im sozialhilferechtlichen Sinne ist der Inbegriff dessen zu verstehen, welcher zur Deckung sozialhilferechtlich anzuerkennender Bedürfnisse oder zur Überwindung oder Milderung von Notlagen erforderlich ist. Dabei kommt es nicht zwingend allein auf die subjektiv-individuellen Bedürfnisse der jeweiligen leistungsberechtigten Person an; entscheidend ist vielmehr, dass die Bedürfnisse auch sozialhilferechtlich anerkannt sind. Sozialhilferechtliche Leistungen – wie auch die Hilfe zur Pflege – müssen zusätzlich sozialhilferechtlich angemessen sein (§ 9 Abs. 2 SGB XII).
Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII sind nachrangig gegenüber gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften (§ 63b Abs. 1 SGB XII). Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften stellen insbesondere die Leistungen nach dem SGB XI (Pflegeversicherung) dar. Allerdings können auch andere Leistungen mit Zweckidentität und Deckung desselben Bedarfs als gleichartig eingestuft werden (beispielsweise Beihilfeleistungen für Beamte/innen).
Die Leistungen nach dem SGB XI sind als vorrangiger Leistungsanspruch gegenüber der Hilfe zur Pflege des SGB XII in Anspruch zu nehmen. Gleichwohl können ergänzende Leistungsansprüche für die Pflegegrade 2-5 nach dem SGB XII bestehen. Diese können z. B. sein:
In diesen Fällen sind die vorrangigen Leistungen des SGB XI auf die SGB XII-Leistungen anzurechnen und die Leistungskonkurrenzregelung des § 63b SGB XII anzuwenden.
Es besteht nach § 62a SGB XII eine Bindungswirkung an die Entscheidungen der Pflegekasse in Bezug auf die Feststellung des Pflegegrades.
Aus dem Ergebnis der Feststellung der Pflegebedürftigkeit ist kein unmittelbarer Rückschluss auf den individuellen tatsächlichen und notwendigen Bedarf an pflegerischen Leistungen möglich. Insofern kann sich die Bindungswirkung nicht auf den konkreten Bedarf der Hilfe zur Pflege beziehen.
Um den Bedarf einer pflegebedürftigen Person festzustellen, ist im Sinne des § 63a SGB XII mit Hilfe des Bedarfsfeststellungsverfahrens und der Hilfeplanung ein gesondertes Verfahren durchzuführen. Dieses Verfahren bezieht die Feststellungen aus dem Gutachten des MD mit ein.
Neben den pflegebedingten Aufwendungen können im Rahmen der Hilfe zur Pflege auch die Kosten berücksichtigt werden, die im Zuge einer Leistungsgewährung nach dem SGB XI außen vor bleiben. Dazu zählen:
Das Einsetzen der Sozialhilfe ist in § 18 SGB XII geregelt. Danach sind Sozialhilfeleistungen zu gewähren, wenn
Beides ist von Amts wegen zu prüfen. Auf den Untersuchungsgrundsatz des § 20 SGB X wird verwiesen. Wird beispielsweise dem Sozialhilfeträger von Dritten (z. B. Nachbarn, Angehörigen, Heim) eine mögliche Sozialhilfebedürftigkeit zu erkennen gegeben, so ist der/die Betreffende auf die Möglichkeit, Leistungen in Anspruch zu nehmen, hinzuweisen.
Zeitpunkt der Leistungsgewährung
Leistungen nach dem SGB XII sind vom Tage des Bekanntwerdens an zu gewähren. Dies gilt nicht für Leistungen der Grundsicherung. Diese sind jeweils rückwirkend zum 01. des Antragsmonats zu gewähren (vgl. § 44 SGB XII). Diese gesonderte Regelung bezieht sich auch für die sozialhilferechtlichen Fälle in einer vollstationären Einrichtung, da in vielen Fällen aufgrund der Berechnungssystematik in der stationären Pflege auch ein Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung besteht. Es ist dabei nicht zu unterscheiden, ob ein Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt in vollstationärer Einrichtung, ein Anspruch auf Grundsicherung oder nur ein Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel besteht.
Anträge können in schriftlicher, fernmündlicher oder mündlicher Form sowie durch einen Vertreter gestellt werden.
Zu näheren Ausführungen wird auf die Verwaltungsanweisung zu § 18 SGB XII verwiesen.
Zeitpunkt der Leistungsgewährung bei Antragsaufnahme in den Pflegestützpunkten
Aufgabe der Pflegestützpunkte stellt gem. § 2 Abs. 1 des Landesrahmenvertrages zur Errichtung und zum Betrieb von Pflegestützpunkten u. a. eine „umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- und landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangeboten“ dar. Aus dieser Aufgabe heraus werden vor Ort auch Hilfestellungen bei der Antragstellung von Leistungen nach dem SGB XII angeboten. Diese Beratungs- und Unterstützungsleistungen gelten auch auf den Sozialhilfeträger bezogen, sofern tatsächlich ein Leistungsanspruch besteht, so dass auch bei Antragsaufnahme innerhalb eines Pflegestützpunktes in Bremen § 18 SGB XII Anwendung findet.
Auf die Bestimmungen des § 44 SGB X (Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes während des laufenden Bezugs von Sozialhilfe wird verwiesen. Danach ist, soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder Beiträge zu Unrecht erhoben worden sind, der Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen.
Entscheidend für eine nachträgliche Gewährung von Sozialhilfe ist jedoch, dass nach Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nur dann Sozialhilfe für die Vergangenheit auszuzahlen ist, wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ein Bedarf besteht und der Bedarf für die Vergangenheit nicht gedeckt wurde. Sollte keine Hilfebedürftigkeit mehr bestehen, da der Bedarf durch Selbsthilfe gedeckt wurde, ist die Leistung nicht nachzuzahlen. Es ist deshalb eine genaue Einzelfallprüfung notwendig.
Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist. Ist ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen worden, werden Sozialleistungen nach den Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuches längstens für einen Zeitraum bis zu vier Jahren vor der Rücknahme erbracht, für Leistungen nach dem SGB XII bis zu einem Jahr (§ 116a SGB XII).
Nach § 13 SGB XII haben ambulante Leistungen vor teilstationären und stationären Leistungen sowie teilstationären vor stationären Leistungen Vorrang. Dieser Vorrang der ambulanten Leistung gilt nicht, wenn eine Leistung für eine geeignete stationäre Einrichtung zumutbar und eine ambulante Leistung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist.
Vor einer Entscheidung in diesem Zusammenhang ist zunächst die Zumutbarkeit im Sinne des § 13 SGB XII zu prüfen.
Bei der Prüfung der Zumutbarkeit sind die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände der leistungsberechtigten Person zu berücksichtigen. Im Rahmen der persönlichen Umstände muss geprüft werden, inwieweit die Verweisung in eine stationäre Einrichtung negative Folgen haben könnte. Aspekte möglicher Negativwirkungen stellen beispielsweise die Unterbringung eines jungen Menschen in einer Einrichtung mit vorwiegend älteren Bewohnern, die Verlegung einer leistungsberechtigten Person mit ausgeprägten Kontaktschwierigkeiten aus der gewohnten häuslichen Umgebung, der Abschied von der vertrauten Wohnung und die mit dem Umzug verbundenen räumlichen Einschränkungen, die Gefahr von durch die Unterbringung in einer stationären Einrichtung bedingten Beziehungs- und Kontaktverlusten oder einer zumindest deutlichen Verringerung derselben, die Gefahr der Vereinsamung der betroffenen Person, die Nähe oder Entfernung zur bisherigen Umgebung dar.
Bei Auszug aus der Häuslichkeit in eine ambulante heimähnliche Wohnform, z. B. eine Demenz-Wohngemeinschaft, und Verbleib innerhalb des Stadtgebietes ist grundsätzlich davon auszugehen, dass auch der Umzug in eine stationäre Wohnform zumutbar ist.
Mit dem Tatbestandsmerkmal „unverhältnismäßige Mehrkosten“ betont der Gesetzgeber, dass Kosten bei der Entscheidung des Hilfeträgers eine Rolle spielen können. Die Kosten, die unter Berücksichtigung des Wunsches erforderlich werden, sind mit denen, die der Hilfeträger aufzuwenden hat, zu vergleichen (BVerwG FEVS 31, 221). Sind die Kosten der gewünschten Unterbringung höher, braucht der Leistungsträger dem Wunsch nicht zu entsprechen. Da es sich um eine Ermessensentscheidung handelt, kann er jedoch andererseits den Wunsch der hilfesuchenden Person respektieren.
Zwischen der gewünschten Hilfemaßnahme, beispielsweise ambulante Versorgung, und der vom Sozialhilfeträger konkret ins Auge gefassten zumutbaren Hilfemaßnahme, beispielsweise stationäre Versorgung, muss ein Kostenvergleich stattfinden. Die Differenz zwischen den verglichenen Positionen beschreibt die Mehrkosten.
Die Unverhältnismäßigkeit liegt hierbei in der Höhe der Differenz. Für die Berechnung der Kosten weist der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. darauf hin, dass die Kostenbestandteile regelmäßig in der ambulanten wie stationären Versorgung aus Kosten für Unterkunft und Heizung, Kosten des Lebensunterhalts zuzüglich eventueller Mehrbedarfe, pflegebedingter Aufwendungen und einem Barbetrag bestehen.
Eine allgemeine Regel, um welchen Betrag oder Prozentsatz die kostengünstigere Bedarfsdeckung überschritten sein muss, um eine Unverhältnismäßigkeit festzustellen, gibt es nicht. Die Umstände des Einzelfalls sind zu berücksichtigen.
Auf Antrag kann die Hilfe zur Pflege auch als Teil und damit als Ergänzung eines trägerübergreifenden Persönlichen Budgets gem. § 63 Abs. 3 SGB XII erbracht werden, sofern Leistungen zur Teilhabe nach dem SGB IX gewährt werden. In § 29 SGB IX ist diesbezüglich unter anderem geregelt, dass budgetfähig beispielsweise auch erforderliche Leistungen der Pflegekassen sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe sind und als Geldleistungen oder durch Gutscheine erbracht werden können.
In § 35a SGB XI ist geregelt, dass Leistungen der Pflegeversicherungen nur bezogen auf die Leistungen der Pflegesachleistung nach § 36 SGB XI, auf das Pflegegeld nach § 37 SGB XI, auf das anteilige und im Voraus bestimmte Pflegegeld der Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI, die zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel nach § 40 Abs. 2 SGB XI und die Kosten für Tages- und Nachtpflege nach § 41 SGB XI budgetfähig sind. Die Sachleistungen nach den §§ 36, 38 und 41 SGB XI dürfen nur in Form von Gutscheinen zur Verfügung gestellt werden, die zur Inanspruchnahme von zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des SGB XI berechtigen.
Die in § 35a SGB XI geltenden Einschränkungen nimmt § 63 Abs. 3 SGB XII nicht vor.
Abzugrenzen sind Leistungen der Hilfe zur Pflege im Rahmen eines Persönlichen Budgets von den Leistungen der „Ambulanten Maßnahmen Persönliche Assistenz (ISB)“ oder des Arbeitgebermodells, siehe auch:
Ambulante Maßnahme Persönliche Assistenz (ISB)
Arbeitgebermodell bei PG 2-5 (§ 64f SGB XII)
Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit sowie des Pflegegrades für pflegeversicherte Pflegebedürftige erfolgt durch die Pflegekasse auf der Grundlage des Gutachtens des MD auf Antrag des Versicherten. Die Entscheidung über den festgesetzten Pflegegrad ist für den Sozialhilfeträger bindend (§ 62a SGB XII).
Die Begutachtung durch den MD trifft keine Aussagen über Art und Umfang des tatsächlichen und notwendigen Bedarfs an Pflege und Hilfe zur Pflege. Auf Grundlage des § 63a SGB XII, wonach der Sozialhilfeträger den notwendigen pflegerischen Bedarf zu ermitteln und festzustellen hat, sind für den Bereich ambulanter Hilfe zur Pflege Verfahren zur Bedarfsfeststellung verabredet worden, die ebenfalls bindend sind.
Für nichtversicherte Pflegebedürftige übernimmt nach Beauftragung durch den Sozialdienst Erwachsene das Gesundheitsamt die Aufgabe der Begutachtung und Feststellung der Pflegegrade. Die Begutachtung erfolgt entsprechend der Begutachtungsrichtlinien des MD. Für nichtversicherte Pflegebedürftige in stationären Einrichtungen kann die Beauftragung direkt durch den Fachdienst Stationäre Leistungen ohne Einbeziehung des SDE erfolgen. Für den Personenkreis in der Zuständigkeit der Behandlungszentren wird der Pflegegrad durch die Behandlungszentren festgestellt (ebenso nach den Begutachtungsrichtlinien des MD).
Für pflegebedürftige Menschen in auswärtigen Einrichtungen ist das Verfahren des dortigen Trägers der Sozialhilfe zu übernehmen.
Begutachtungsrichtlinien und Richtlinien zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit (Stand 17.05.2021)
Eine Pflegebedürftigkeit wird nach dem SGB XI verneint, wenn diese nicht von Dauer ist. Im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII kann jedoch auch eine kurzfristige Pflegebedürftigkeit einen Leistungsanspruch auslösen (§ 61 SGB XII). Von Bedeutung kann dieser Sachverhalt insbesondere bei der Kurzzeitpflege (vorübergehende Pflegebedürftigkeit nach Krankenhausaufenthalt), aber auch in anderen Fallkonstellationen (z. B. Notwendigkeit einer vorübergehenden Versorgung durch einen Pflegedienst) sein. Liegen hierfür Anhaltspunkte vor, ist das Gesundheitsamt bzw. Behandlungszentrum durch den Sozialdienst Erwachsene zu beauftragen, ein entsprechendes Gutachten und ggf. eine Bedarfsfeststellung zu erstellen.
In § 63a SGB XII ist geregelt, dass der Sozialhilfeträger den notwendigen pflegerischen Bedarf zu ermitteln und festzustellen hat. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, wurde das Fachkonzept zur Hilfeplanung für den Sozialdienst Erwachsene (SDE) für Menschen mit Bedarf an Hilfe zur Pflege eingeführt. In diesem wird das Verfahren der Feststellung des Bedarfs an Hilfe zur Pflege und im nächsten Schritt die Berücksichtigung dessen im Rahmen der Hilfeplanung beschrieben.
Die Verfahren der Bedarfsfeststellung und der Hilfeplanung in der Hilfe zur Pflege und damit die verbindliche Beteiligung von Pflegefachkräften bei der Bedarfsermittlung sind seit 2011 durch Beschlüsse der Deputationen „Gesundheit und Soziales“ eingeführt worden. Zunächst erfolgte eine projekthafte Erprobung und nach Auswertung dieses Verfahrens in 2014 eine Verstetigung.
Grundlage dieser Beschlüsse war die Erkenntnis, dass ein wichtiges Steuerungselement in der Hilfe zur Pflege die Feststellung des pflegerischen Bedarfes darstellt und es deshalb hierfür dauerhaft einer besseren und systematischen Einzelfallsteuerung bedurfte. Das Ziel war, eine bedarfsgerechte Versorgung und gleichzeitig einen wirtschaftlichen Versorgungsstandard zu erreichen. Dieses hat auch weiterhin Gültigkeit.
Das Zusammenwirken von Pflegefachlichkeit und sozialer Arbeit und damit die Koppelung verschiedener Systeme mit ihren eigenen Logiken ermöglicht eine wirksame Unterstützung in interprofessioneller Kooperation. Dieses setzt eine Klärung von Zuständigkeiten und Rollen voraus.
Inzwischen haben die meisten deutschen Großstädte eine Beteiligung von Pflegefachkräften an der Feststellung pflegerischer Bedarfe entweder in ihrer eigenen Organisation oder durch Kooperation mit den kommunalen Gesundheitsämtern eingeführt.
Die Zielsetzung einer Hilfeplanung in der Hilfe zur Pflege ist die gesundheitliche und soziale Versorgung eines pflegebedürftigen Menschen. Dabei sind die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung eines pflegebedürftigen Menschen zu erhalten und zu fördern.
Für die pflegebedürftige Person hat der Verbleib in der gewohnten Häuslichkeit in der Regel eine hohe Priorität. Das ambulante Versorgungssystem ist deshalb zu stützen. Sozialraumbezogene Versorgungsstrukturen sind zu nutzen. Dabei werden die Ressourcen der Familie, Freunde, Nachbarn und des gesamten Wohnumfeldes mit einbezogen.
Der SDE ist im Amt für Soziale Dienste in den Sozialzentren und im Fachdienst Teilhabe für die Hilfeplanung der Hilfe zur Pflege für alle erwachsenen Menschen, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII haben, fallführend und fallverantwortlich. Der Dienst wird dabei durch die Pflegefachkräfte des Gesundheitsamtes Bremens (GAB) unterstützt.
Aufgrund der sozialräumlichen Organisationsstruktur des Amtes für Soziale Dienste verfügt der SDE über sozialraumbezogene Kenntnisse und Kontakte, d. h. er ist Teil der örtlichen Netzwerke.
Der SDE nutzt dabei Grundprinzipien und Instrumente des Case-Managements und berücksichtigt möglichst die Autonomiewünsche der pflegebedürftigen Person unter Einbeziehung ihrer realen oder potentiellen Ressourcen. Er steuert und optimiert einzelfallbezogen komplexe Versorgungsprozesse durch Kooperation und Koordination aller beteiligten Akteure.
Die Kompetenzen und Aufgaben ‚Sozialer Arbeit’ grenzen sich von denen der medizinischen und pflegerischen Qualifikationen grundsätzlich ab. ’Soziale Arbeit’ konzentriert sich auf die Bewältigung sozialer Probleme. Die vielfältigen Verflechtungen medizinischer und sozialer Probleme bei Pflegebedürftigkeit erfordern eine enge Kooperation zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen.
Der SDE ist mit seiner sozialpädagogischen Qualifikation, u. a. der psychosozialen Diagnostik, der Beratungs- und Sozialrechtskompetenz und unter Berücksichtigung der fachpolitischen Ziele in der Lage, diesen Hilfeprozess einzuleiten und zu steuern.
Pflegebedürftige Menschen befinden sich häufig in einer für sie neuen, schwierigen psychosozialen Situation und benötigen eine umfassende Beratung und Unterstützung zur Reduzierung und/oder Beseitigung ihrer vielschichtigen Notlagen. Der Fokus liegt zunächst oft in der medizinisch-pflegerischen Bedarfslage.
Die Pflegefachkräfte des GAB verfügen über Kenntnisse von Krankheitsbildern, Krankheitsverläufen und über die Vermeidung von Folgerisiken (Prophylaxen) sowie die Notwendigkeit körperbezogener Pflege und Behandlungspflege. Sie haben den Auftrag, insbesondere im gesundheitlichen Bereich präventive Gesichtspunkte (zum Beispiel in der Rehabilitation vor Einsatz von Pflegeleistungen) zu berücksichtigen. Pflegefachlichkeit darf sich deshalb nicht nur auf die Definition der Pflege nach dem SGB XI begrenzen. Sie ist umfassender zu betrachten. Es sind alle im Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit entstehenden Hilfebedarfe aufzunehmen.
Durch eine verbindliche und auf alle medizinisch-pflegerischen Bedarfe ausgerichtete Beteiligung der Pflegefachkräfte wird eine umfassende Bedarfsbeschreibung ermöglicht. Ein im Rahmenkonzept des SDE beschriebenes präventives Leitbild wird dadurch unterstützt.
Im Ergebnis werden die sozialpädagogischen und pflegerischen Kompetenzen zusammengeführt und bieten in ihrer multidimensionalen Fallbetrachtung eine komplexere und miteinander abgestimmte Bedarfsbeschreibung.
Das Verfahren zur Hilfeplanung ist interprofessionell ausgerichtet. Es verbindet die medizinisch-pflegerische mit der sozialpädagogischen Fachkompetenz. Diese Ausrichtung ermöglicht beiden Professionen eine enge Kooperation und Koordination in diesem Prozess.
Pflegebedürftigkeit bedeutet oft eine tiefgreifende Zäsur im Leben von Menschen. Die initiale Unsicherheit in dieser belastenden Lebensphase kann durch professionelle individuelle Beratung, Unterstützung bei der Organisation von Hilfen, Angebote zur Krankheitsbewältigung und ressourcenorientierte pflegerische Edukation (Hilfe zur Selbsthilfe) gemildert werden. Menschen sind unter dem Eindruck von akuten, schweren Erkrankungen oft am ehesten bereit, Lebensverhältnisse und Gewohnheiten dauerhaft zu verändern.
Der Pflegebedürftigkeitsbegriff betont die Orientierung an Ressourcen pflegebedürftiger Personen und die Nutzung von präventiven und rehabilitativen Potenzialen. Pflege muss keineswegs das Endstadium der gesundheitlichen Versorgungskette sein. Deshalb sollen die präventiven und rehabilitativen Möglichkeiten im Hilfeplanverfahren optimiert werden. Dies erfolgt durch die Empfehlungen in den Bedarfsfeststellungen der Pflegefachkräfte und einer aktivierenden Pflege. Die Implementation zielgenauer pflegerischer Hilfen ist bereits die erste Stufe präventiver Wirksamkeit und kann einen längeren Verbleib in der Häuslichkeit ermöglichen. Kernaufgabe der sozialen Arbeit stellt zudem die Beratung dar. Die Beratung ist gerade zu Beginn der Pflegebedürftigkeit eine wichtige Informationsquelle und Motivationsunterstützung für die pflegebedürftige Person. Eine an individuellen Vorwissen und biographischen Prägungen (Lebenswelt) ansetzende Beratung hat erhebliches Potenzial, mit der Belastungssituation bei Pflegebedürftigkeit konstruktiv umgehen zu können (Coping). Sie kann die Akzeptanz von angebotenen Pflegehilfen stärken, Motivation zur Problembewältigung wecken und bei Bedarf konkret helfen, Hilfen einzusetzen. Dabei ist das direkte soziale Umfeld in die Beratung möglichst einzubeziehen, um dort mögliche entstehende Überforderungen zu erkennen oder zu vermeiden.
Pflege ist im Kern präventive Tätigkeit. Pflegehandlungen dienen seit jeher präventiven Zielen, sie sind klassischer Teil der Tertiärprävention (= Folgeschäden von Erkrankungen verzögern, begrenzen, verhindern mittels pflegerischer Prophylaxen). Aber auch Primärprävention (Vorbeugung von Krankheiten durch Verhaltens- oder Verhältnisänderung) und Sekundärprävention (Früherkennung von Krankheiten) sind für Pflegebedürftige relevant, um ihre Gesundheit zu sichern und zu fördern. Dabei ist Gesundheit kein rein funktionaler oder medizinisch eingeengter Begriff. Die WHO definiert Wohlbefinden als zentrale Kategorie von Gesundheit. Pflegerische und sozialarbeiterische Tätigkeiten dienen somit u. a. auch dem Ziel, das meist beeinträchtigte Wohlbefinden pflegebedürftiger Menschen trotz Krankheit und/oder Behinderung zu fördern und ihre Lebensqualität zu erhalten.
Ziel des Verfahrens ist ein Assessment durch beide Professionen in ihrer jeweiligen Kompetenz bei allen Hilfeplanungen für Menschen mit pflegerischen Bedarfen in den jeweils festgelegten Begutachtungszeiträumen.
Die Wirksamkeit der empfohlenen und/oder eingesetzten Pflegemaßnahmen ist davon abhängig, ob diese die pflegebedürftige Person auch erreichen. Deshalb ist es auch im Sinne von Prävention notwendig, nach dem Einsetzen die Wirksamkeit zu überprüfen und ggf. nachzusteuern oder den Hilfeplan anzupassen.
Dabei sind insbesondere folgende Fragestellungen zu beantworten:
Deshalb ist seitens des SDE über die eingesetzten oder noch ausstehenden Pflegemaßnahmen mit der pflegebedürftigen Personen spätestens nach 3–6 Monaten und möglichst in der eigenen Häuslichkeit zu beraten und das Ergebnis zu dokumentieren.
Ziel der Beratung ist es, die pflegebedürftige Person zu befähigen, aus einer Vielzahl von Leistungen und Möglichkeiten eine eigenständige Entscheidung für die individuelle Pflegesituation zu treffen. Dabei sind immer die Ressourcen aus dem Umfeld zu berücksichtigen.
Beratung findet immer im gegenseitigen Einvernehmen statt und ist neutral und unabhängig hinsichtlich der Angebote unterschiedlicher Träger.
Beratung stellt im Sinne von § 14 SGB I eine umfassende Beratung im eigenen Zuständigkeitsbereich des SGB XII dar und bezieht Rechte und Pflichten mit ein. Hinsichtlich möglicher Leistungen außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereiches ist nach § 15 SGB I auf den zuständigen Leistungsträger zu verweisen.
Die Beratung des SDE im Kontext der Hilfeplanung Hilfe zur Pflege erfolgt auf Grundlage des ermittelten Bedarfes durch die Pflegefachkräfte des Gesundheitsamtes Bremens.
Die Beratung nach § 14 SGB I und die Auskunft nach § 15 SGB I umfassen alle sozialen Angelegenheiten, Beratung zur Hilfeplanung und beratende Unterstützung bei der Umsetzung festgestellter Hilfebedarfe. Die Beratung zu medizinischen und/oder pflegerischen Fragestellungen erfolgt durch das GAB und ist ggf. im Einzelfall vom SDE zu koordinieren.
Die Ergebnisse der Beratung sind zu dokumentieren.
Der SDE berät pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen zur Verbesserung der individuellen Pflegesituation und organisiert die entsprechende Unterstützung. Konkret nutzt er dabei auch die Empfehlungen aus der Eingraduierung des Pflegegrades (festgestellt durch den MD oder das GAB), aus der Bedarfsfeststellung und des Beratungsbesuchs des Gesundheitsamtes, z. B. für Hilfsmittel, Heilmittel oder Rehabilitationsmaßnahmen.
Die Unterstützung zielt insbesondere darauf ab, eine Verbesserung der Pflegesituation zu erreichen. Diesbezüglich erforderlich ist eine Besprechung mit der pflegebedürftigen Person und -sofern gewünscht- eine Unterstützung des Organisationsprozesses bis zur Umsetzung. Die verfügbaren Ressourcen im Umfeld der pflegebedürftigen Person sind dabei zu nutzen. Diese können sich auf pflegende Angehörige, Nachbarn, Pflegepersonen, Pflegedienste, rechtliche Betreuungspersonen oder andere Personen beziehen.
Der SDE im Amt für Soziale Dienste als Bestandteil des Trägers der Sozialhilfe hat folgende Aufgaben im Kontext der Leistungsgewährung der Hilfe zur Pflege:
Die Durchführung der Aufgaben der Pflegefachkräfte des Gesundheitsamtes Bremen erfolgt im Auftrag des Trägers der Sozialhilfe im Sinne einer Auftragsverarbeitung nach § 28 der Datenschutzgrundverordnung.
Aufgaben sind insbesondere:
Das GAB ist für diese Auftragsverarbeitung stets durch den SDE zu beauftragen – eine Ausnahme von dieser Regelung liegt bei einer zu erstellenden Begutachtung einer Pflegebedürftigkeit von nicht pflegeversicherten Personen in stationären Einrichtungen vor. In diesen Fällen kann die Beauftragung direkt durch den Fachdienst Stationäre Leistungen erfolgen.
Die Zusammenarbeit der Fachkräfte in gemeinsamen Fallbesprechungen und in gemeinsamen Hausbesuchen erfolgt kooperativ und kollegial. Gemeinsame Fallbesprechungen dienen dem Austausch zu:
Die Fallbesprechungen dienen zusätzlich dem Informationsaustausch, Fachaustausch, der Verfahrenssicherheit, Qualitätssicherung und der Entwicklung einer optimalen Versorgung der pflegebedürftigen Person.
Gemeinsame Fallbesprechungen können sowohl in Präsenz, telefonisch oder auch per Videokonferenz durchgeführt werden. Die Terminierung erfolgt nach Bedarf und in Absprache mit den zu beteiligten Pflegefachkräften und dem Amt für Soziale Dienste.
Sollte es zwischen den Fachkräften des Amtes für Soziale Dienste und den Fachkräften des Gesundheitsamtes zu unterschiedlichen Einschätzungen der körperbezogenen Pflegemaßnahmen, der pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und/oder der Hilfen bei der Haushaltsführung kommen, wird dies zeitnah mit dem Ziel der Herstellung eines Konsenses erörtert und im Hilfeplan dokumentiert.
Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, so ist eine einvernehmliche Entscheidung gemeinsam mit dem jeweils nächsten Vorgesetzten anzustreben.
Kann auch dann keine Einigung erzielt werden, verbleibt wegen der Fallverantwortung des Sozialdienstes Erwachsene für die Hilfeplanung die Entscheidung beim zuständigen Sozialzentrum oder Fachdienst.
In der Regel soll beim Erstbesuch ein gemeinsamer Hausbesuch erfolgen. Bei Folgebesuchen stellt der gemeinsame Hausbesuch weiterhin das Ziel dar, die Durchführung in der Praxis ist jedoch nicht immer sinnvoll oder möglich. Die Verabredungen dazu erfolgen zwischen den Fachkräften.
Gem. § 63a SGB XII haben die Träger der Sozialhilfe den notwendigen pflegerischen Bedarf zu ermitteln und festzustellen. In Bremen wurde dieser Auftrag an das Gesundheitsamt Bremen durch die dort beschäftigten Pflegefachkräfte im Referat Pflege/Gesundheit älterer Menschen übertragen.
Die Bedarfsfeststellung erfolgt für alle pflegerischen Bedarfe durch die Pflegefachkraft unabhängig vom Pflegegrad, unabhängig vom Leistungsanbieter oder der Maßnahme und unabhängig vom Rechtskreis.
Die Pflegefachkräfte beurteilen die Notwendigkeit von Pflege nach Leistungskomplexen anhand des vorliegenden Gutachtens des MD und/oder dem Vorgutachten des GAB, ggf. aktueller medizinisch-pflegerischer Zusatzinformationen und den Feststellungen während des Hausbesuches. Die Bedarfsfeststellung erfolgt nach den im Einzelfall festgestellten gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten und den sich daraus ableitenden notwendigen Unterstützungsleistungen im Sinne des § 61a SGB XII.
Die Bedarfsfeststellung bezieht die Beurteilung der Notwendigkeit von Hilfs- und Heilmitteln - unabhängig der Gesetzesnorm- im Sinne von Prävention und Erleichterung der Pflege mit ein. Dieses kann sich auch auf therapeutische und rehabilitierende Angebote nach dem SGB V sowie auf alle weiteren möglichen Hilfsmitteln beziehen.
Die Beurteilung des pflegerisch notwendigen Bedarfs im Sinne des § 63a SGB XII erfolgt nach den aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen unter Beachtung der fachlichen Standards.
Die Feststellung der Bedarfe und auch die Abrechnung der Leistungen erfolgt entsprechend der festgestellten notwendigen Pflegehandlungen, die in sogenannten Leistungskomplexen (LK) zusammengefasst sind. Die Leistungskomplexe werden im Rahmen der Landesvereinbarung zur Vergütung von Leistungen der häuslichen Pflege nach §§ 36 und 39 SGB XI festgelegt. Daraus resultiert auch die Beschreibung der einzelnen Leistungskomplexe.
Die Leistungskomplexe sind mit Punkten versehen, die mit € - Beträgen vergütet werden, unabhängig davon, wie viel Zeit z. B. für das morgendliche Waschen, Anziehen etc. tatsächlich gebraucht wird. Die Punktzahlen stellen Durchschnittswerte dar, die je nach Pflegebedarf in der Einzelfallpraxis über- oder unterschritten werden können, ohne dass sich die Vergütung dafür ändert (Grundwerte). Die Pflegedienste sind vertraglich verpflichtet, die Pflegeleistung nach individuellem Bedarf zu erbringen.
Die Leistungskomplexe beinhalten körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung (§ 36 SGB XI). In den Leistungen ist das Prinzip der aktivierenden Pflege, die darauf ausgerichtet ist die körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte wiederzugewinnen oder zu erhalten, enthalten (§ 2 SGB XI).
Bei pflegebedürftigen Personen, die bei den benötigten Leistungskomplexen einen sehr hohen Hilfebedarf auf Dauer haben, reichen die den Leistungskomplexen hinterlegten Punktzahlen teilweise nicht aus und können auch nicht in dem erforderlichen Umfang bei anderen Leistungskomplexen ausgeglichen werden. Diese Personen können zusätzliche Punkte erhalten, die sich an dem zusätzlichen durchschnittlichen Bedarf bemessen. Der Durchschnittsbedarf orientiert sich an Mittelwertschwankungen, angelegt auf eine absehbare Zeit und auf einen insgesamt gesehen üblichen Tagesablauf.
Eine Erhöhung der vorgegebenen Punktzahlen der Leistungskomplexe für körperbezogene Pflegemaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung gilt im Regelfall nur, wenn
Eine Punktwerterhöhung innerhalb eines Leistungskomplexes ist auch möglich, wenn diese lediglich zu bestimmten Zeiten erforderlich wird. Beispielhaft kann dies der Fall sein, wenn der Pflegeaufwand einer notwendigen Lagerung tagsüber außergewöhnlich hoch ist, da die pflegebedürftige Person dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen ist, die nächtliche Lagerung im Bett jedoch keines weiteren außergewöhnlichen Aufwands bedarf.
Die Voraussetzungen einer Punktwerterhöhung sind pflegefachlich durch das GAB zu beurteilen.
Außerhalb des Landes Bremens gelten die im jeweiligen Bundesland getroffenen Leistungskomplexe entsprechend der dortigen Landesvereinbarungen und daraus resultierenden Leistungskomplexbechreibungen. Die festgestellten Bedarfe nach Leistungskomplexen sind auf den Leistungskomplexkatalog des jeweiligen Bundeslandes möglichst zu übertragen. Diese Regelung trifft insbesondere dann zu, wenn ein Leistungsanbieter Niedersachsens die ambulante pflegerische Versorgung eines im Randgebiet Bremens lebende pflegebedürftige Person übernimmt.
Die Hilfeplanung erfolgt auf Basis der Bedarfsfeststellung der Pflegefachkräfte und den Feststellungen des SDE. In der Hilfeplanung werden die aktuelle Wohn- und Lebenssituation, die körperliche und seelische Verfassung, noch vorhandene Kompetenzen, mögliche Defizite sowie die soziale Einbindung und das Unterstützungspotential im häuslichen Umfeld berücksichtigt und dokumentiert. Im Hilfeplan werden die persönlichen Vorstellungen der pflegebedürftigen Personen Person Menschen bezüglich der Lebens- und Hilfegestaltung eingebunden. Der SDE entscheidet bei Bedarf über die Heranziehung weiterer Experten.
Grundsätzlich ist dem Ergebnis der Bedarfsfeststellung der Pflegefachkräfte zu folgen. Soll in der Hilfeplanung von der Bedarfsfeststellung abgewichen werden, sind die Gründe zu benennen und im Hilfeplan zu dokumentieren. Die Abweichung ist in der gemeinsamen Fallbesprechung mit den Pflegefachkräften zu thematisieren. Ziel ist es dabei, einen Konsens herzustellen.
Der SDE unterstützt die pflegebedürftigen Menschen bei der Umsetzung notwendiger und gewollter Hilfen.
Im Umgang mit dem Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI oder nach § 64i SGB XII wirkt der SDE auf eine Inanspruchnahme und sinnvolle Verwendung hin. Die Verwendung des Entlastungsbetrages wird im Hilfeplan an der dafür vorgesehenen Stelle dokumentiert.
Zur Finanzierung der notwendigen Hilfen werden die Wirtschaftlichen Hilfen frühzeitig einbezogen. Den Wirtschaftlichen Hilfen wird nach Fertigstellung der Hilfeplan mit einer Kopie der seitens des GA erstellten Bedarfsfeststellung zugeleitet. Eine Kopie des Hilfeplanes wird dem GA zugeleitet.
Der Zeitraum der Hilfeplanung beträgt in der Regel zwei Jahre. Bei Anzeichen eines veränderten dauerhaften pflegerischen Bedarfes ist vor Ablauf der 2 Jahre eine neue Hilfeplanung zu erstellen und damit eine neue Bedarfsfeststellung beim GAB zu beauftragen.
Im Folgenden werden die Regelungen und Leitlinien zu den einzelnen Elementen der Begutachtung, Bedarfsfeststellung und Hilfeplanung dargestellt.
Das Begutachtungsinstrument der Pflegeversicherung zur Feststellung einer Pflegebedürftigkeit und eines Pflegegrades ist analog auch im SGB XII anzuwenden (§ 15 SGB XI und § 61a SGB XII). Das Formulargutachten aus den „Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches“ ist zu verwenden. Begutachtungsrichtlinien und Richtlinien zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit (Stand 17.05.2021)
Liegt eine kurzzeitige Pflegebedürftigkeit vor, wird der MD eine Beeinträchtigung in der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten nicht feststellen können. Voraussetzung für die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XI ist eine bestehende dauerhafte Pflegebedürftigkeit, die bei jedem Kriterium der einzelnen Module beurteilt wird.
Grundsätzlich ist der Pflegebedürftigkeitsbegriff im SGB XI und SGB XII identisch. Die einzige Ausnahme bezieht sich auf die Dauer der Pflegebedürftigkeit. Im Gegensatz zu den bestehenden Regelungen des SGB XI ist im Sinne des § 61 SGB XII in der Hilfe zur Pflege eine Leistungsberechtigung nicht von der Dauer einer Pflegebedürftigkeit abhängig. Damit kann in der Hilfe zur Pflege auch eine Leistungsberechtigung bestehen, sofern eine Pflegebedürftigkeit nicht von Dauer (also unterhalb von 6 Monaten) festgestellt worden ist. Die Begutachtung erfolgt diesbezüglich durch das Gesundheitsamt oder das zuständige Behandlungszentrum.
Von Bedeutung kann dieser Sachverhalt insbesondere bei der Kurzzeitpflege sein (vorübergehende Pflegebedürftigkeit nach Krankenhausaufenthalt), aber auch in anderen Fallkonstellationen. Liegen hierfür Anhaltspunkte vor, ist für die Erstellung eines entsprechenden Gutachtens das Gesundheitsamt bzw. Behandlungszentrum zu beauftragen. Dieses Verfahren leiten die zuständigen Sozialdienste ein.
Im Zusammenhang mit der Begutachtung und Bedarfsfeststellung der Hilfe zur Pflege nach den §§ 61-66 SGB XII, der Haushilfe nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII und der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes nach § 70 SGB XII kann der Dolmetscherdienst in Anspruch genommen werden.
Inhalte und Ziele:
Ziel der Inanspruchnahme des Dolmetscherdienstes ist die Verbesserung der Verständigungsmöglichkeit mit nicht deutschsprechenden und verstehenden Menschen bei den Begutachtungen und Bedarfsfeststellungen der oben benannten Hilfearten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Art und der Umfang der im Einzelfall erforderlichen Hilfe beurteil werden kann und daraus resultierend eine qualitätsgesicherte Hilfeplanung ermöglicht und implementiert wird. Die Inanspruchnahme des Dolmetscherdienstes soll auch die Möglichkeit der Sprachmittlung durch Pflegedienste eingrenzen.
Inanspruchnahme:
Es ist der kommunale Dolmetscherdienst Bremen in Anspruch zu nehmen.
Die an dem Verfahren beteiligten Dienste beurteilen die Notwendigkeit der Inanspruchnahme in eigener Verantwortung. Diese Beurteilung ist verbindlich. Stellt der Sozialdienst Erwachsene die Notwendigkeit der Inanspruchnahme eines Dolmetschers fest, informiert er die begutachtende Pflegefachkraft des Gesundheitsamtes entsprechend.
Kosten:
Die Kosten werden in einem vom Amt für Soziale Dienste mit der Performa Nord abgestimmten Verfahren durch die Haushaltsabteilung der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration nach Zeichnung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit überwiesen.
Dolmetscherdienst Handlungshilfe
Die Wirtschaftlichen Hilfen entscheiden auf Grundlage des Hilfeplans und sind für die Umsetzung der begründeten und damit nachvollziehbaren Pflegemaßnahmen in das Verwaltungsverfahren zuständig.
Die Wirtschaftlichen Hilfen sind frühzeitig in die Zuständigkeitsprüfung und Prüfung der sozialhilferechtlichen Anspruchsvoraussetzungen einzubeziehen.
Der Bescheid über die zu bewilligenden Leistungen an Hilfe zur Pflege geht an die leistungsberechtigte Person.
Die Leistungserbringenden erhalten Kostenzusicherungen mit Angaben über die bewilligten Leistungskomplexe und als Anlage die bewilligten Leistungskomplexe aus dem Hilfeplan. Eine Kopie der Kostenzusicherung wird dem Sozialdienst Erwachsene zugeleitet.
Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zwei Jahre und entspricht dem Zeitraum des Hilfeplans.
Gem. § 18 Abs. 3 SGB XI wird das Gutachten des MD der antragstellenden Person durch die Pflegekasse übersandt, wenn er der Übersendung nicht widerspricht. Für die vom Gesundheitsamt und vom Sozialdienst Erwachsene oder den Behandlungszentren erstellten Gutachten (Eingraduierung) und/oder Hilfepläne ist analog zu verfahren. Die vom Gesundheitsamt erstellten Bedarfsfeststellungen, welche Empfehlungen darstellen, werden auf Wunsch/Anforderung an die leistungsberechtigte Person weitergeleitet.
Grundsätzlich wird der Bedarf an Leistungen der Hilfe zur Pflege nach den vereinbarten Leistungskomplexen gewährt.
Insbesondere bei Sicherstellung der häuslichen Pflege über das Angebot der „Ambulanten Maßnahme Persönliche Assistenz“ (ISB), als Arbeitgebermodell, durch Einsetzen eines ambulanten Betreuungsdienstes oder einer Haushaltshilfe erfolgt eine zeitabhängige Bewilligung der Leistungen.
Die Umrechnung der Punkte in Zeit erfolgt wie folgt:
Pflegedienst (1 Min. = 10 Punkte) | wchtl. Punktzahl / 10 Punkte / 7 Tage / 60 Minuten = tgl. Stundensatz |
LK 12 – 17 (1 Min. = 6 Punkte) | wchtl. Punktzahl / 6 Punkte / 7 Tage / 60 Minuten = tgl. Stundensatz |
Pflegepersonen / besondere Pflegekräfte alle LK (1 Min. = 3,65 Punkte) | wchtl. Punktzahl / 3,65 Punkte / 7 Tage / 60 Minuten = tgl. Stundensatz |
Eine Umrechnung der durch die Leistungskomplexe ermittelten Punkte in Zeit bei anderen Leistungsanbietern entfällt grundsätzlich, da diese zeitunabhängig erbracht werden und den gesamten sozialhilferechtlich notwendigen Bedarf abgelten.
Die leistungsberechtigte Person darf zwischen einer zeitabhängigen und einer zeitunabhängigen Vergütung wählen. Entscheidet sich die leistungsberechtigte Person für eine zeitabhängige Vergütung, verwendet sie dafür die im Hilfeplanverfahren nach Leistungskomplexen festgestellte und errechnete Leistung und verpflichtet sich zur Sicherstellung der Pflege im festgestellten Umfang. In diesem Zusammenhang muss auf den sozialhilferechtlichen Grundsatz der Notwendigkeit verwiesen werden, s. auch: Notwendiger und angemessener Bedarf.
Im § 64 SGB XII ist der Subsidiaritätsgedanke des Sozialhilferechtes genannt, wonach der Sozialhilfeträger darauf hinwirken soll, dass bei häuslicher Pflege die Pflege durch Personen, die der pflegebedürftigen Person nahestehen, oder als Nachbarschaftshilfe übernommen wird. Unter dem Begriff der Pflege sind die körperbezogenen Pflegemaßnahmen, die pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung gemeint. Nahestehende Personen sind in erster Linie Familienangehörige, Haushaltsangehörige, enge Freunde und gute Bekannte.
Daraus ergibt sich eine eindeutige Hinwirkungspflicht des Sozialhilfeträgers, nahestehende Personen in die pflegerische Versorgung einzubeziehen, wenn diese erreichbar ist. Mit der Vorschrift aus § 64 SGB XII geht einher, dass die Pflege vorrangig durch Pflegegeld sichergestellt werden soll.
Pflegegeld bei PG 2-5 (§ 64a SGB XII)
In § 63 SGB XII sind die Leistungen der Hilfe zur Pflege für Pflegebedürftige aufgeführt. Auch in der Hilfe zur Pflege haben Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 einen nur eingeschränkten Zugang zum Leistungskatalog der Hilfe zur Pflege, während Pflegebedürftige der Pflegegrade 2–5 einen vollen Zugang genießen. Auf die Nachrangigkeit der Hilfe zur Pflege und vorrangige Inanspruchnahme insbesondere von Leistungen nach dem SGB XI wird an dieser Stelle nochmals verwiesen.
Die Hilfe zur Pflege umfasst gem. § 63 Abs. 1 SGB XII für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5:
Die Hilfe zur Pflege umfasst gem. § 63 Abs. 2 SGB XII für Pflegebedürftige des Pflegegrades 1:
Die Aufzählung ist abschließend. Der Gesetzgeber möchte mit dieser inhaltsgleichen Regelung aus dem SGB XI erreichen, dass die benannten Leistungen grundsätzlich einen Verbleib in der häuslichen Umgebung sicherstellen. Die gesetzgeberische Begründung dieser Regelung ist, dass die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten im Pflegegrad 1 gering ausgeprägt und deshalb nur eingeschränkte Leistungen notwendig sind.
Insbesondere nach Inkrafttreten des PSG III zum 01.01.2017 wurde deutlich, dass es in der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII zu Versorgungs- bzw. Finanzierungslücken kommen kann. Dieses liegt insbesondere daran, dass die vollen Leistungen der Hilfe zur Pflege erst ab Pflegegrad 2 gewährt werden dürfen. Pflegebedürftige im Pflegegrad 1 haben nur einen eingeschränkten Zugang auf das Leistungssystem der Hilfe zur Pflege.
Die Begrenzung der Leistungen der Hilfe zur Pflege und Pflege nach dem SGB XI erfolgte vor dem Hintergrund, dass Teilhilfen bei der Selbstversorgung als ausreichend angesehen wurden. Insgesamt stehen deshalb beratende und edukative Leistungen im Vordergrund, die den Verbleib in der häuslichen Umgebung sicherstellen, ohne dass bereits voller Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung angezeigt ist.2 Die dem Pflegegrad 1 zugeordneten Fälle haben zum Teil jedoch einen wesentlich höheren (Finanzierungs-)Bedarf, so dass Versorgungs- und Finanzierungslücken bestehen. Die Beeinträchtigung der Selbstständigkeit im somatischen Bereich liegend kann zwar gering sein, erfordert aber trotzdem umfangreichere personelle Unterstützung, bzw. kann auch bei einer geringen Teilhilfe die volle Inanspruchnahme eines Leistungskomplexes auslösen.
In der Hilfe zur Pflege des 7. Kapitels des SGB XII besteht keine Möglichkeit, die eingeschränkten Leistungen auszuweiten. Um dem Bedarfsdeckungsprinzip gerecht zu werden, ist es daher notwendig, Maßnahmen außerhalb der Hilfe zur Pflege zu etablieren.
Zu den im Pflegegrad 1 ergänzenden Maßnahmen gehören:
Bei einer Gewährung ergänzender Leistungen können sowohl notwendige körperbezogene Pflegemaßnahmen als auch pflegerische Betreuungsmaßnahmen (Leistungskomplexe 26/27) auch in Verbindung mit Hilfen bei der Haushaltsführung in Betracht kommen. Voraussetzung für eine Bewilligung bei Vorliegen des PG 1 ist, dass der von der Pflegekasse oder dem Sozialhilfeträger bewilligte Entlastungsbetrag in Höhe von 125 € zunächst für die körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen und/oder den Hilfen bei der Haushaltsführung eingesetzt wird. Sofern die Höhe des Entlastungsbetrages nicht ausreicht, um den notwendigen Bedarf zu decken, sind die körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen (und ggf. in Verbindung mit der Hilfen bei der Haushaltsführung) im notwendigen Umfang zu gewähren. Hinsichtlich der Notwendigkeit ist das standardisierte Verfahren zur Bedarfsfeststellung anzuwenden.
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Maßnahmen zur sozialen Teilhabe im Rahmen der Altenhilfe schließen sich in der Regel gegenseitig aus.
Werden körperbezogene Pflegemaßnahmen gemeinsam mit Hilfen bei der Haushaltsführung durch einen Pflegedienst erbracht, sind alle Leistungen nach § 73 SGB XII zahlbar zu machen.
In den folgenden Punkten werden die rechtlichen Grundlagen und Regelungen zur Gewährung eines Pflegegeldes im Rahmen des SGB XII thematisiert. Die Regelungen zum gekürzten Pflegegeld nach § 63b Abs. 5 SGB XII sind hier aufgeführt: Gekürztes Pflegegeld (§ 63b Abs. 5 SGB XII)
Ein Anspruch auf Pflegegeld besteht bei häuslicher Pflege für Pflegebedürftige, bei denen ein Pflegegrad 2-5 festgestellt wurde und ihre Pflege mit dem Pflegegeld in geeigneter Weise – durch Einsatz von Pflegepersonen – selbst sicherstellen. Auf den möglichen Personenkreis der Hilfe zur Pflege und dem vorrangigen Leistungsanspruch des SGB XI wird verwiesen.
Personenkreis der Hilfe zur Pflege
Die pauschalierte Höhe der Pflegegelder ist in Abhängigkeit des festgestellten Pflegegrades identisch mit denen des § 37 Abs. 1 SGB XI; mit dem Pflegegeld sind die erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen, pflegerischen Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung - wie nach dem SGB XI - umfassend sicherzustellen. Das pauschalierte Pflegegeld wird ungeachtet der tatsächlichen Aufwendungen und eines darüber zu führenden Nachweises als Geldleistung gewährt. Der Zweck des Pflegegeldes liegt unter anderem darin, neben der Abdeckung des entstehenden Pflegeaufwandes, es den pflegebedürftigen Personen zu ermöglichen, die Pflegebereitschaft der in § 64 SGB XII genannten Personen zu erhalten oder zu wecken.
Wird ein Pflegebedürftiger von seinem Partner oder von seinem Verwandten ersten oder zweiten Grades gepflegt, ist davon auszugehen, dass das Pflegegeld nicht weitergeleitet wird und zwar unabhängig davon, ob die Betreffenden in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Das Pflegegeld wird somit nicht als Einkommen der Pflegeperson berücksichtigt.
Ob Anspruch auf Pflegegeld für insbesondere nichtpflegeversicherte Pflegebedürftige besteht, begutachtet das Gesundheitsamt (der Sozialmedizinische Dienst für Erwachsene, bzw. die Sozialpädiatrische Abteilung für Kinder) sowie bei psychisch kranken Menschen die sozialpsychiatrischen Beratungsstellen in den regionalen Behandlungszentren. Bei der Begutachtung wird der Grad der Pflegebedürftigkeit nach der entsprechenden Richtlinie der Spitzenverbände der Pflegekassen festgestellt.
Ergeben sich aus dem Gutachten des Gesundheitsamtes Bremen Empfehlungen, sind diese zu beachten und der SDE zu beteiligen.
Besteht bei der Pflegekasse ein Anspruch auf Pflegegeld nach den §§ 37 oder 38 SGB XI und leistet der Sozialhilfeträger zusätzlich Leistungen nach § 64a (Pflegegeld) und/oder § 64b (häusliche Pflegehilfe) SGB XII, kann die leistungsberechtigte Person von der Umwidmungsmöglichkeit des § 45a Abs. 4 SGB XI keinen Gebrauch machen. Sie ist verpflichtet die vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung in voller Höhe auszuschöpfen, s. auch Umwandlungsanspruch bei PG 2-5 (§ 45a Abs. 4 SGB XI).
Ein Anspruch auf Pflegegeld besteht nur, wenn die pflegebedürftige Person mit dem Pflegegeld die erforderliche Pflege (körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung) in geeigneter Weise selbst sicherstellt. Wird oder kann das Pflegegeld nicht für den bestimmten Zweck verwendet werden, besteht kein Anspruch.
In Artikel 51 Abs. 1 des Pflegeversicherungsgesetzes (PflegeVG) ist geregelt, dass die Personen, die am 31.03.1955 ein Pflegegeld nach § 69 des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) in der bis zum 31.03.1995 geltenden Fassung bezogen haben, dieses Pflegegeld und zusätzlich das bis zum 31.03.1955 nach § 57 SGB V gezahlte Pflegegeld vom Sozialhilfeträger erhalten. Mit dieser Regelung wurde gleichzeitig eine Besitzstandsregelung eingeführt, die in Einzelfällen noch Berücksichtigung finden kann.
Entscheidend für den Besitzstand ist nicht, dass zum damaligen Zeitpunkt eine (erhebliche) Pflegebedürftigkeit im Sinne des SGB XI vorgelegen hat oder ein Pflegegeld nach § 57 SGB V bezogen wurde, sondern es muss ein Anspruch auf ein Pflegegeld zum 31.3.1995 nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) bestanden haben.
Die im SGB XI vorgenommenen Dynamisierungen der Leistungen der §§ 36 bis 38 und 41 SGB XI mindern den Anspruch nach Art. 51 PflegeVG. Es sind deshalb Änderungen in der Leistungshöhe des Anspruchs nach Art. 51 PflegeVG bei Änderung der vorgenannten Leistungen des SGB XI vorzunehmen.
Festlegung der Leistung:
Zur Festlegung des Besitzstandes wurden am 1.4.1995 die maßgeblichen Grundbeträge der Einkommensgrenzen nach §§ 79 und 81 BSHG (Stand: 31.3.1995) sowie die maßgeblichen Beträge der Durchführungsverordnung des § 88 Abs. 2 Nr. 8 BSHG (ebenfalls Stand 31.3.1995) zugrunde gelegt. Die Einkommensgrenzen wurden zwar zum 1.1.2005 neu geregelt, sind aber für diesen Personenkreis nicht relevant. Im Übrigen gelten die Vorschriften des SGB XII. Hiermit ist gemeint, dass die Besitzstandsregelung nur solange gilt, wie Sozialhilfebedürftigkeit vorliegt. Wird der Hilfebezug längerfristig unterbrochen (Einstellung aufgrund höherer Einkommens- oder Vermögenswerte), besteht bei erneuter Antragsstellung kein Besitzstandsschutz mehr.
Der Besitzstand mindert sich um:
Bei Anhebungen der Leistungen der Pflegeversicherung, sind die Fälle, die einen Anspruch auf die Besitzstandsregelung haben, entsprechend anzupassen. Befindet sich die anspruchsberechtigte Person in einer statw3ionären Einrichtung (z. B. Kurzzeitpflege), ruht der Anspruch auf das ambulante Pflegegeld und somit der Besitzstand.
Insbesondere nichtpflegeversicherte Menschen haben einen Anspruch auf ein nicht gekürztes Pflegegeld nach § 64a SGB XII, wenn das Gesundheitsamt eine Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 2 festgestellt hat und die häusliche Pflege selbst durch nahestehende Personen sichergestellt wird.
Eine Qualitätssicherung ist im SGB XI gem. § 37 Abs. 3 SGB XI durch verbindliche Beratungsbesuche geregelt. Im SGB XII fehlt diese Regelung. Eine Qualitätskontrolle für Leistungsberechtigte von Pflegegeld nach § 64a SGB XII ist gesetzlich nicht vorgesehen.
Im Sinne einer Qualitätssicherung der Pflege ist auch für Leistungsbeziehende eines ungekürzten Pflegegeldes nach § 64a SGB XII die Einführung eines Verfahrens notwendig, welches die Qualität der Pflege bewertet.
Ziel
Zielsetzung dieser Beratungsbesuche stellt die Hilfestellung, Beratung zur Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege sowie das Aussprechen von Empfehlungen bezogen auf mögliche erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegesituation dar. Mit den Beratungsbesuchen soll eine pflegefachliche Unterstützung zur Optimierung der Versorgungssituation erfolgen.
Der Leistungsinhalt der Beratung bezieht sich auf:
Die Zielsetzungen der Beratungsbesuche entsprechen denen des SGB XI.
Verbindlichkeit und Pflegesicherstellung
Die Beratungsbesuche sind verbindlich in Anspruch zu nehmen. Sie fallen unter die Mitwirkungspflichten der §§ 62-65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I). Auf § 66 Abs. 2 SGB I wird verwiesen. Das Pflegegeld dient dem Zweck, die erforderliche Pflege durch die pflegebedürftige Person bzw. bei pflegebedürftigen Kindern durch die Personensorgeberechtigten in geeigneter Weise selbst sicherzustellen. Wird dieser Zweck nicht erfüllt, muss möglicherweise eine Umstellung der pflegerischen Versorgung (beispielsweise durch Einsatz eines Pflegedienstes) erfolgen.
Durchführung
Die Beratungsbesuche werden von den Pflegefachkräften des Gesundheitsamtes vom Sozialmedizinischen Dienst für Erwachsene und für pflegebedürftige Kinder von der sozialpädiatrischen Abteilung des Gesundheitsamtes durchgeführt. Der Beratungsbesuch soll einmal jährlich, anlassbezogen auch häufiger nach Empfehlung der Pflegefachkraft durchgeführt werden.
Verfahren
Leistungen der häuslichen Pflegehilfe, der Verhinderungspflege, Leistungen im Rahmen des Arbeitgebermodells sowie gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden neben einem Pflegegeld nach § 64a SGB XII erbracht.
In diesen Fällen und um eine mögliche doppelte Bedarfsdeckung zu vermeiden, ist in § 63b Abs. 5 SGB XII geregelt, dass das Pflegegeld um bis zu zwei Drittel gekürzt werden kann. Eine Kürzung um zwei Drittel führt zu einer Gewährung eines gekürzten Pflegegeldes je nach Pflegegrad um ein Drittel. Die Verpflichtung und Notwendigkeit, dass die erforderliche Pflege in geeigneter Weise selbst sicherzustellen und das Pflegegeld zweckbestimmt einzusetzen ist, gilt auch hier (§ 64a Abs. 1 S. 2 SGB XII).
Der Gesetzgeber hat dem Sozialhilfeträger in zweifacher Hinsicht einen Ermessensspielraum eingeräumt. Es muss entschieden werden:
und
Bei dieser Ermessensentscheidung ist entscheidend, in welchem Umfang der mit der Gewährung des Pflegegeldes verbundene Zweck zur eigenen Sicherstellung der Pflege erfüllt wird und inwiefern andere Leistungen nach §§ 64b, 64c oder 64f Abs. 3 SGB XII (häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells) überflüssig gemacht werden. Dabei ist auf die Besonderheiten des Einzelfalles abzustellen. Eine schematische Kürzung darf nicht vorgenommen werden, sie führt zur Rechtswidrigkeit der Entscheidung.
Der Charakter des Pflegegeldes besteht unter anderem darin, die Pflegebereitschaft der Pflegeperson zu wecken oder zu erhalten. Des Weiteren stellt das Pflegegeld eine zweckgerichtete Aufwandspauschale dar, mit Hilfe derer die mittelbar mit der Pflegebedürftigkeit zusammenhängenden Mehrkosten abgedeckt werden sollen. Der Gesetzgeber stellt insbesondere darauf ab, dass mindestens 1/3 des Pflegegeldes dazu bestimmt ist, die Pflegebereitschaft von ehrenamtlichen Pflegepersonen oder Angehörigen zu erhalten. Es ist zu berücksichtigen wie sich das Verhältnis des Pflegeeinsatzes von ehrenamtlichen Pflegepersonen (und Angehörigen) zum Einsatz angestellter und aus öffentlichen Mitteln finanzierter Pflegekräfte darstellt. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass je größer der Anteil der von der Pflegeperson übernommenen Pflege am Gesamtpflegebedarf ist, desto geringer die Kürzung des Pflegegeldes auszufallen hat. Die volle Kürzung um 2/3 ist nur dann zulässig, wenn ausnahmslos alle Aufwendungen durch den Sozialhilfeträger in vollem Umfang auch tatsächlich gleistet werden. Andernfalls ist eine pauschale Kürzung ohne Würdigung des Einzelfalles nicht ermessensfehlerfrei.
Häusliche Pflegehilfe für Pflegebedürftige ab PG 2 umfasst die notwendigen Leistungen der körperbezogenen Pflegemaßnahmen, pflegerischen Betreuungsmaßnahme und Hilfen bei der Haushaltsführung. Der Inhalt der Leistungen ist identisch mit den Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI. Mit der häuslichen Pflegehilfe ist grundsätzlich der Einsatz eines Pflegedienstes auch in Verbindung mit dem Einsatz eines ambulanten Betreuungsdienstes oder eines Dienstleistungszentrums verbunden. Für pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung können insbesondere auch Bremer Dienstleistungszentren, ambulante Betreuungsdienste oder Anbieter anerkannter Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI eingesetzt werden.
Von einer Leistungserbringung der pflegerischen Betreuungsleistungen im häuslichen Umfeld wird dann davon auszugehen sein, wenn ein enger räumlicher Bezug zur Wohnung besteht. Die Unterstützung muss neben dem räumlichen Bezug auch im engen sachlichen Bezug zur Bewältigung und Gestaltung des alltäglichen Lebens im Haushalt erfolgen.
Voraussetzung für die Gewährung einer häuslichen Pflegehilfe nach § 64b SGB XII ist die Notwendigkeit der Hinzuziehung einer besonderen Pflegekraft und die fehlende Sicherstellung der häuslichen Pflege durch ein Pflegegeld. Daraus resultiert, dass zusätzliche regelmäßige Leistungen durch nahestehenden Personen oder Personen, die keine „besondere Pflegekraft“ darstellen, im Rahmen der Gewährung einer häuslichen Pflegehilfe ausgeschlossen werden (mit Ausnahme bei Gewährung eines Entlastungsbetrages nach § 64i oder § 66 SGB XII für nichtversicherte Pflegebedürftige).
Leistungen für privat gesuchte Pflegepersonen (z. B. für Hilfen in der Haushaltsführung oder pflegerischen Betreuungsmaßnahmen) sind nur möglich, wenn die Pflege nicht durch das Pflegegeld sichergestellt werden kann. Das ist dann der Fall, wenn ein Pflegegeld nicht oder nur teilweise gezahlt wird, weil Pflegesachleistungen in Anspruch genommen werden. Eine alleinige Leistung für Pflegepersonen ist nicht möglich.
Werden nach § 64b SGB XII Leistungen für einen Pflegedienst erbracht, können die leistungsberechtigten Personen von der Umwidmungsmöglichkeit des § 45a Abs. 4 SGB XI keinen Gebrauch machen. Sie sind gem. § 63b SGB XII verpflichtet, die vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung in voller Höhe auszuschöpfen.
Der notwendige pflegerische Bedarf wird in zeitunabhängige Leistungskomplexe dargestellt und zusammengefasst. Körperbezogene Pflegemaßnahmen werden innerhalb der Leistungskomplexe 1-11, Hilfen bei der Haushaltsführung innerhalb der Leistungskomplexe 12-17 sowie pflegerische Betreuungsmaßnahmen innerhalb der Leistungskomplexe 26/27 erfasst.
Die Vergütung eines Pflegedienstes erfolgt grundsätzlich im Rahmen der durch die Leistungskomplexe ermittelten zeitunabhängigen Punktwerte in Höhe des in der jeweiligen Vergütungsvereinbarung getroffenen Punktwertes. Zusätzlich ist im Land Bremen auch eine zeitabhängige Vergütung bei Einsatz eines Pflegedienstes innerhalb der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen vereinbart worden. Die Vergütung eines ambulanten Betreuungsdienstes und des Dienstleistungszentrums erfolgt nach einer Zeitvergütung.
Die leistungsberechtigte Person darf nach dem Willen des Gesetzgebers zwischen einer zeitabhängigen Vergütung (in Minuten/Stunden) und einer zeitunabhängigen Vergütung (nach Leistungskomplexen) wählen. Entscheidet sich die leistungsberechtigte Person für eine zeitabhängige Vergütung, verwendet sie dafür die im Hilfeplanverfahren nach Leistungskomplexen festgestellte und danach errechnete Leistung (in €) und verpflichtet sich zur Sicherstellung der Pflege im festgestellten Umfang. Bei einer zeitabhängigen Vergütung wird der Bedarf an Hilfe zur Pflege nicht in Zeit/Stunden bewilligt, sondern in der Höhe der zur Verfügung stehenden Leistungshöhe in EURO.
Insbesondere bei Sicherstellung der häuslichen Pflege über das Angebot der „Ambulanten Maßnahme Persönliche Assistenz“ (ISB), als Arbeitgebermodell, durch Einsetzen eines ambulanten Betreuungsdienstes oder einer Haushaltshilfe erfolgt eine zeitabhängige Bewilligung der Leistungen.
Die Umrechnung der Punkte in Zeit erfolgt sodann wie folgt:
Pflegedienst LK 1 – 11 (1 Min. = 10 Punkte) | wchtl. Punktzahl / 10 Punkte / 7 Tage / 60 Minuten = tgl. Stundensatz |
LK 12 – 17 (1 Min. = 6 Punkte) | wchtl. Punktzahl / 6 Punkte / 7 Tage / 60 Minuten = tgl. Stundensatz |
Pflegepersonen / besondere Pflegekräfte alle LK (1 Min. = 3,65 Punkte) | wchtl. Punktzahl / 3,65 Punkte / 7 Tage / 60 Minuten = tgl. Stundensatz |
Für die Hilfen bei der Haushaltsführung ist Ziel der Stadtgemeinde Bremen, Haushaltshilfen weitestgehend über die dezentral in den Stadtteilen verorteten Dienstleistungszentren (DLZ) im Rahmen der sogenannten Organisierten Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Der Sozialdienst hat im Rahmen seiner Beratungstätigkeit auf Grundlage des § 63a SGB XII auf die Option der Organisierten Nachbarschaftshilfe hinzuwirken. Gleichwohl ist festzuhalten, dass diese Form der Haushaltshilfe nicht zwingend ist. Möglich ist beispielsweise auch ein Einsatz einer privat gesuchten Haushaltshilfe oder eines ambulanten Betreuungsdienstes (siehe dazu auch „Verwaltungsanweisung zu Leistungen für hauswirtschaftliche Verrichtungen – Haushaltshilfe“ Verwaltungsanweisung Unterstützung Haushaltsführung/Haushaltshilfe.
Die in der Verwaltungsanweisung „Leistungen für hauswirtschaftliche Verrichtungen – Haushaltshilfe“ beschriebene Regelung, den Bedarf für Haushaltshilfen und Organisierter Nachbarschaftshilfe nach Leistungskomplexen zu ermitteln und in Stunden/Minuten darzustellen, ist auch in der Hilfe zur Pflege anzuwenden. Bei Einsetzen eines DLZ oder einer privat gesuchten Haushaltshilfe ist das Endergebnis ist auf volle 30 Minuten aufzurunden.
Ebenso ist die in dieser Verwaltungsanweisung beschriebene Regelung über private Haushaltshilfen zur Anmeldung einer haushaltsnahen Dienstleistung oder der Anmeldung bei Überschreitung des Einkommens aus einer geringfügigen Beschäftigung, ist auch für privat gesuchte Pflegepersonen anzuwenden. Auch die dort beschriebenen Regelungen zur Höhe der Leistungen gelten ebenso für den hauswirtschaftlichen Bedarf, wenn dieser der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII zugeordnet ist.
Die investitionsbedingten Aufwendungen (Bereitstellung und Erhaltung der betriebsnotwendigen Anlagen einschl. ihrer Ausstattung des ambulanten Pflegedienstes) werden von den Pflegekassen aus Mitteln des SGB XI nicht übernommen.
Das Entgeltreferat der Behörde hat mit Leistungsanbietern der ambulanten, der teilstationären und der stationären Pflege Vereinbarungen gem. §§ 75 SGB XII geschlossen, die vorsehen, dass investitionsbedingte Aufwendungen in der vereinbarten Höhe aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen werden, sofern im Einzelfall
• ein Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach den Bestimmungen des 7. Kapitels des SGB XII besteht und
• die sozialhilferechtlichen Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung vorliegen.
Die Investitionskosten sind mit den Leistungen der häuslichen Pflegehilfe nach § 64b SGB XII (bei PG 2-5) zu gewähren. Sollte ein ambulanter Pflegedienst im Rahmen einer Leistungserbringung nach dem 3., 4. oder 9. Kapitel des SGB XII Kosten erhalten, sind auch in diesem Zusammenhang die Investitionskosten zu berücksichtigen.
Werden lediglich Investitionskosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege beantragt, ist zu prüfen ob die Pflegesachleistung nach § 36 SGB XI durch die Pflegekasse vollständig ausgeschöpft sind und damit ein Anspruch auf ein restliches Pflegegeld nach § 38 SGB XI (im Rahmen von Kombinationsleistungen), aus denen die Investitionskosten gezahlt werden könnten, nicht besteht. In diesem Zusammenhang sind auch die Regelungen zu dem gekürzten Pflegegeld nach § 63b Abs. 5 SGB XII zu berücksichtigen.
Zur Prüfung, ob eine Leistungsgewährung für die Investitionskosten möglich ist, sind die Rechnungen des Pflegedienstes an die Pflegekasse einzusehen. Eine Prüfung der Angemessenheit bezogen auf die reine Gewährung von Investitionskosten, z. B. durch eine Bedarfsfeststellung des Gesundheitsamtes, bedarf es nicht.
Zur Beseitigung des Mangels an Ausbildungsplätzen in der Altenpflege und Pflege wird in Bremen ein Ausgleichsverfahren zur Aufbringung der Mittel für die Kosten der Ausbildungsvergütung durchgeführt. Sowohl ambulante, teilstationäre als auch stationäre Pflegeeinrichtungen (d. h. ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeheime, Tagespflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen) haben Abgaben zu entrichten, die wiederum der pflegebedürftigen Person in Rechnung gestellt werden dürfen.
Die Umlage ist in der Hilfe zur Pflege zu übernehmen, wenn ein ambulanter, teilstationärer oder stationärer Leistungserbringer entsprechende Leistungen erbringt, die sozialhilferechtlich notwendig und anerkannt worden sind.
Umlage nach dem Pflegeberufegesetz
Das Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz) trat stufenweise ab Juli 2017 in Kraft. Die bis dahin im Altenpflegegesetz und im Krankenpflegegeldgesetz getrennt geregelten Pflegeausbildungen wurden in diesem Pflegeberufegesetz zusammengeführt. Die Kosten der Ausbildung dieser Pflegeausbildung werden durch einen Ausgleichsfond finanziert. In Bremen wurde die Verordnung zur Finanzierung der Pflegeausbildung im Land Bremen in Kraft gesetzt. Die daraus resultierenden und seitens des Statistischen Landesamtes Bremen errechneten Umlagen können im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII übernommen werden.
Das Umlageverfahren nach dem Pflegeberufegesetz steht in enger Abhängigkeit eines pflegerischen Leistungsbezuges im Sinne des SGB XI bzw. der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Die Berücksichtigung der Umlage aufgrund der Gewährung von Leistungen nach dem 3., 4. oder 9. Kapitel des SGB XII (z. B. bei Aufstockung von Leistungen bei PG 1 oder bei Gewährung von hauswirtschaftlichen Verrichtungen im Rahmen existenzsichernder Leistungen) ist nicht vorgesehen und daher nicht berücksichtigungsfähig.
Im Rahmen des Arbeitgebermodells können Pflegebedürftige der Pflegegrade 2-5 die häusliche Pflege durch von ihnen angestellte besondere Pflegekräfte sicherstellen. Die häusliche Pflege kann körperbezogene Pflege, pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung umfassen. Die pflegebedürftige Person richtet für die benötigte Pflege, Unterstützung und Betreuung, hauswirtschaftliche Verrichtungen einen oder mehrere versicherungspflichtige Arbeitsplätze ein, die ggf. auch mit Mini-Jobs ergänzt werden können. Das Arbeitgebermodell erfordert ein hohes Maß an Eigenverantwortung; andererseits garantiert es eine Flexibilität.
Der Zugang zum Arbeitgebermodell setzt voraus, dass das Direktionsrecht auch in sinnvoller Weise ausgeübt werden kann. Dies ist der Fall, wenn die leistungsberechtigte Person selbst über genügend Anleitungs- und Alltagskompetenz verfügt, um selbstständig anzuleiten. Weitere Kompetenzen zur Ausübung der „Rechte und Pflichten“ als Arbeit gebende Instanz müssen vorhanden sein. Die Beurteilung der Kompetenzen erfolgt im Rahmen des Hilfeplanverfahrens.
Bei der eingestellten Pflegekraft muss es sich um eine „besondere Pflegekraft“ handeln. Dieser Begriff ergibt sich zwar nicht aus dem Gesetzestext, wird in der Gesetzesbegründung jedoch eindeutig formuliert, so dass das Vorliegen einer „besonderen Pflegekraft“ als zwingend notwendig gedeutet wird. Angehörige oder anderweitig nahestehende Personen gelten nicht als besondere Pflegekraft (in diesen Fällen wäre das Pflegegeld nach dem SGB XI oder SGB XII für die pflegerische Bedarfsdeckung einzusetzen).
Bei Anerkennung des Arbeitgebermodells sind im Rahmen der Hilfe zur Pflege die angemessenen Kosten zu übernehmen.
Pflegeversicherte Pflegebedürftige können für dieses Modell seitens ihrer Pflegekasse das Pflegegeld nach § 37 SGB XII in Anspruch nehmen. Das Pflegegeld ist auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege anzurechnen. Ein Verweis auf die Inanspruchnahme von Sachleistungen ist nicht möglich (§ 63b Abs. 6 SGB XII).
Der Begriff der „besondere Pflegekraft“ im Sinne dieser Bestimmung ist nicht mit der Bezeichnung z. B. einer Fachkraft eines Pflegedienstes vergleichbar, sondern ist weiter auszulegen.
„Besondere Pflegekräfte“ sind z. B. Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, Krankenpflegehelfer*innen, Altenpfleger*innen, Altenpflegehelfer*innen, Pflegeassistent*innen oder Gemeindeschwestern. Keine „besonderen Pflegekräfte“ sind nahestehende Personen, Nachbarschaftshilfen oder durch sonstige, zum gesellschaftlichen Engagement bereite Personen. Im Sinne des § 64f SGB XII sind Pflegekräfte bereits dann „besondere“ i. S. des § 64f Abs. 3 SGB XII, wenn sie nicht in häuslicher oder nachbarschaftlicher Verbundenheit nach § 64f SGB XII pflegen. Die Pflegekraft muss von der zu pflegenden Person angelernt und in ihre Arbeit eingewiesen werden können.
Nur für „besondere Pflegekräfte“ kann eine Entlohnung im angemessenen Umfang erfolgen. Handelt es sich nicht um eine „besondere Pflegekraft“, sondern um eine nahestehende Person im Sinne des § 64 SGB XII, ist eine Leistung im Sinne des § 64f Abs. 3 SGB XII nicht zu gewähren.
Die Angemessenheit ist hinsichtlich des Bedarfsumfanges und hinsichtlich der Vergütung zu beurteilen.
Angemessen sind die Kosten, die nach der Gegebenheit des Einzelfalles notwendig sind, die Pflege nach den anerkannten Standards des SGB XI zu sichern, d. h. den unerlässlichen Pflegeaufwand für die notwendigen Pflegetätigkeiten sicherzustellen. Die angemessenen Kosten ergeben sich aus dem Hilfeplanverfahren. Angemessen der Höhe nach sind die ortsüblichen und vereinbarten Entgelte. Es ist eine seriöse Kalkulation des zu erwartenden Gesamtbudgets einzureichen und zu prüfen. Die Höhe soll die möglichen Leistungen einer häuslichen Pflegehilfe und der damit verbundenen möglichen Kosten auf Grundlage vereinbarter Sätze abzüglich der möglichen Pflegesachleistungen nach dem SGB XI nicht überschreiten. Ein Kostenvergleich ist mit vereinbarten Sätzen für ambulante Pflegedienste, ambulante Betreuungsdienste oder auch niedrigschwellige Angebote im Sinne von § 45a SGB XI möglich. Bei dieser Anerkenntnis sind aufzuwendende Arbeitgebersachkosten und der Overheadanteil enthalten und können nicht zusätzlich geltend gemacht werden.
Eine monatliche Rechnungstellung ist nicht erforderlich. Bei Pflegegeldbezug nach dem SGB XI wird die Qualität der Pflege im Rahmen des SGB XI durch entsprechende Beratungsbesuche geprüft, für nicht pflegeversicherte Personen ist das GAB einzubeziehen.
Mit Einführung des § 71 Abs. 1a SGB XI hat der Gesetzgeber die Zulassung „ambulanter Betreuungsdienste“ als Leistungserbringer geregelt. Betreuungsdienste sind ambulante Betreuungseinrichtungen, die für Pflegebedürftige dauerhaft pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung erbringen. Sie erbringen keine körperbezogenen Pflegemaßnahmen.
Wie ambulante Pflegedienste schließen Betreuungsdienste einen Versorgungsvertrag und darauf aufbauend eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung ab. Erst mit Abschluss der Leistungs- und Entgeltvereinbarung im Einvernehmen mit dem Sozialhilfeträger können die angemessenen und notwendigen Kosten im Rahmen der Hilfe zur Pflege übernommen werden.
Der Entlastungsbetrag kann für die Leistungserbringung ambulanter Betreuungsdienste eingesetzt werden. Eine Gewährung im Rahmen existenzsichernder Leistungen kann nur bei einem Einsatz zur Erbringung von Hilfen bei der Haushaltsführung in begründeten Fällen entsprechend der Verwaltungsanweisung zu „Haushaltshilfen“ erfolgen.
Qualitätsanforderungen und Versorgungsvertrag
Seitens der ambulanten Betreuungsdienste sind definierte Qualitätsanforderungen zu erfüllen (benannt in § 113b Abs. 4 Nr. 3 SGB XI, bzw. in den Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes nach §§ 112a SGB XI zu den Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Qualitätssicherung für ambulante Betreuungsdienste). Diese Anforderungen beziehen sich u. a. auf ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement, räumliche Voraussetzungen, Konzeption des Betreuungsdienstes, personelle Qualitäts- und Strukturanforderungen unter Einbeziehung einer verantwortlichen (Pflege-)Fachkraft, durchzuführende Weiterbildungsmaßnahmen der Beschäftigten oder ein individuelles Einarbeitungskonzept.
Auf Basis der zu erfüllenden Anforderungen kann ein Versorgungsvertrag zwischen Anbieter und Pflegekassen im Rahmen des SGB XI geschlossen werden.
Angebot in Bremen
In Bremen wurden bisher im Einvernehmen mit dem Sozialhilfeträger 2 Vergütungsvereinbarungen mit dem Anbieter „4your.care“, Graf-Moltke-Str. 30, 28211 Bremen und dem Sozialwerk der Freien Christengemeinde, Große Johannisstraße 141-147, 28199 Bremen geschlossen. Der Bedarf an Leistungen der pflegerischen Betreuungsmaßnahme und Hilfen bei der Haushaltsführung ist entsprechend dieser Vereinbarung nach Stunden/Minuten und auf volle 30 Minuten aufgerundet abzurechnen. Eine Vergütung nach Leistungskomplexen ist in diesem Fall ausgeschlossen.
Feststellung des Bedarfs und zeitlicher Umfang
Die in dieser Verwaltungsanweisung geregelten Leitlinien zur Feststellung des Bedarfs behalten auch in diesem Setting ihre Gültigkeit. Die Feststellung des Bedarfs von Hilfen zur Haushaltsführung inkl. pflegerischen Betreuungsmaßnahmen ist im Hilfeplan 188c über „besondere Pflegekraft“ und „Pflegeperson“, von ausschließlich Hilfen zur Haushaltsführung im Hilfeplan 185b über „Haushaltshilfe“ abzubilden.
Die Umrechnung der Punkte in Zeit im Rahmen des Hilfeplanes 188c erfolgt wie folgt:
Pflegepersonen / besondere Pflegekräfte alle LK (1 Min. = 3,65 Punkte) | wchtl. Punktzahl / 3,65 Punkte / 7 Tage / 60 Minuten = tgl. Stundensatz |
Eingabe in OpenProsoz
Die errechnete Vergütung ist in gewohnter Weise in OpenProsoz unter dem Bedarf „Haushaltshilfen“ einzugeben.
§ 19 Abs. 6 SGB XII regelt den Anspruch von berechtigten Personen auf Leistungen für Einrichtungen oder auf Pflegegeld nach dem Tod der berechtigten Person, soweit ein Anspruch besteht und die Leistung erbracht wurde.
Unter dem Einrichtungsbegriff fallen per se keine ambulanten Pflegedienste mit der Folge, dass ambulante Pflegedienste bei Versterben der pflegebedürftigen Person keinen Anspruch auf Vergütung der erbrachten Leistungen haben, sofern über die Bewilligung von Hilfe zur Pflege noch nicht entschieden werden konnte. Das Bundessozialgericht hat diese Regelung bestätigt.
Der Deutsche Städtetag hat durch diese Auslegung negative Auswirkungen auf die ambulante Versorgungslandschaft befürchtet. Konkret bezog sich der Deutsche Städtetag auf Fälle, in denen ambulante Pflegedienste wegen des bestehenden Kostenrisikos eine Übernahme der Pflege ablehnen. Er hat eine ernsthafte Gefährdung der Versorgung gesehen, sofern ein ambulanter Pflegedienst erst durch tatsächlich erfolgte Kostenzusage des Sozialhilfeträgers tätig wird.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sieht keine Notwendigkeit, eine Gesetzesänderung vorzunehmen. In der Begründung wird ausgeführt, dass ambulante Dienste als nicht besonders schutzwürdig eingestuft werden, da diese in der Regel eine Zusage zur Kostenübernahme vor der eigentlichen Leistungsgewährung durch den Sozialhilfeträger erhalten.
Aus Sicht des Sozialhilfeträgers in Bremen ist eine Kostenzusage vor der Leistungsgewährung eines ambulanten Pflegedienstes nicht immer sichergestellt. Einzelfälle bestätigen diesen Sachverhalt. Zur Sicherstellung der Versorgung ist es jedoch notwendig, dass ein Pflegedienst mit der Leistung beginnt, auch bevor eine Kostenzusage erfolgt ist. Er muss auch dann auf eine Leistung des Sozialhilfeträgers im angemessenen Umfang vertrauen können. Aus diesem Grunde wird die Regelung zu § 19 Abs. 6 SGB XII insofern konkretisiert, dass diese nicht anzuwenden ist, wenn die Bewilligung der Leistung bereits erfolgt ist, die Kosten allerdings noch nicht gezahlt werden konnten. In diesem Fall kann der Leistungsanbieter den aus der Bewilligung gegenüber der leistungsberechtigten Person erwachsenen unmittelbaren Anspruch gegenüber dem Sozialhilfeträger geltend machen.
Eine mündliche Kostenzusage durch das zuständige Sozialzentrum, bzw. den zuständigen Fachdienst ist einer formalen schriftlichen Kostenzusage gleichzusetzen.
Die Leistung eines ambulanten Pflegedienstes ist deshalb trotz Versterben der berechtigten Person auch ohne formale Bescheiderteilung und Kostenzusage in der Höhe wie sie erbracht worden wäre, für längstens 10 Wochen nach Feststellung über das Vorliegen der Voraussetzungen zu zahlen.
Die Vorrausetzungen für die Zahlung gegenüber einem Pflegedienst liegen vor, wenn
Gem. § 63b Abs. 3 SGB XII erhalten pflegebedürftige Menschen keine Leistungen der häuslichen Pflege während eines stationären oder teilstationären Aufenthaltes. Der Sozialhilfeträger hat hier kein Ermessen. Damit scheiden Leistungen der häuslichen Pflege während eines teilstationären oder stationären Aufenthaltes aus. Der Anspruch auf ein Pflegegeld nach § 64a SGB XII entfällt somit und zwar unabhängig, ob es gem. § 63b Abs. 5 SGB XII gekürzt oder ungekürzt geleistet wird. Da das Pflegegeld eine pauschale Leistung darstellt und deshalb keine Nachweispflicht über die Verwendung des Pflegegeldes besteht, wird es in der Praxis schwierig sein, innerhalb eines Bedarfsmonats eine Einstellung des Pflegegeldes wegen eines stationären Aufenthaltes zu realisieren. Es ist deshalb bei einem stationären Aufenthalt erst mit Beginn des Folgemonats einzustellen. Eine Weitergewährung erfolgt mit dem Tag der Entlassung aus einer stationären Einrichtung.
Bei einem teilstationären Aufenthalt, z. B. in einer Tagespflege ist davon auszugehen, dass ein Pflegegeld für die häusliche Pflege verwendet wird.
Die Regelung, dass häusliche Pflege nicht während eines teilstationären oder stationären Aufenthaltes zu gewähren ist, gilt nicht für den sogenannten Assistenzpflegebedarf.
Durch das Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus vom 30.07.2009 und vom 20.12.2012 gilt die Regelung des § 63b Abs. 3 SGB XII (kein Anspruch auf häusliche Pflege bei einem teil- oder vollstationären Aufenthalt) nicht bei einem vorübergehenden Aufenthalt in einem Krankenhaus nach § 108 SGB V oder einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nach § 107 Abs. 2 SGB V, soweit die pflegebedürftige Person ihre Pflege durch von ihr selbst beschäftigte besondere Pflegekräfte sicherstellt.
In diesen Fällen wird durch diese Gesetzesregelungen sichergestellt, dass die Leistungen der Hilfe zur Pflege auch während eines Krankenhausaufenthalts nach § 108 SGB V oder eines Aufenthalts in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nach § 107 Abs. 2 SGB V gewährt werden können. Die Praxis hatte vor Einführung dieser Regelung gezeigt, dass die pflegerische Versorgung behinderter Menschen in Krankenhäusern oft unzureichend war. Der Gesetzgeber hat mit Einführung dieser Regelung auf dieses Praxisproblem reagiert, um damit die pflegerische Versorgung von behinderten Menschen während eines vorübergehenden Krankenhausaufenthaltes in einem Krankenhaus im ausreichenden Maße sicherzustellen. Es handelt sich also um den pflegerischen Bedarf, der über die Leistungen der Krankenhausbehandlung nach § 39 SGB V hinausgehend ist.
In der Praxis werden die pflegebedürftigen Menschen einen Anspruch auf Assistenzpflege im Krankenhaus oder in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung haben, die die Pflege im Rahmen des Persönlichen Budgets oder durch Arbeitgebermodelle selbst sicherstellen und einen hohen Pflegebedarf haben. Der Bedarf an Assistenzpflege ist individuell zu beurteilen.
Im Einzelfall ist abzugrenzen, welcher Bedarf durch die Leistungen der Krankenhausbehandlung umfasst ist und welcher Bedarf im Sinne einer Assistenz zusätzlich notwendig ist. Die Leistungen der Krankenhausbehandlung sind nach dem SGB XII nicht zu übernehmen.
Gem. § 34 Abs. 2 SGB XI wird das Pflegegeld für den genannten Personenkreis auch nach den ersten vier Wochen weitergezahlt. Die Leistungen nach dem SGB XI sind auf die Leistungen nach dem SGB XII anzurechnen.
Nach § 64c SGB XII besteht auch in der Hilfe zur Pflege ein Anspruch auf Verhinderungspflege für pflegebedürftige Personen der PG 2-5, wenn die Pflegeperson, die die häusliche Pflege im Sinne des § 64a SGB XII sicherstellt, wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus sonstigen Gründen verhindert ist.
Der Anspruch auf Verhinderungspflege entspricht dem Inhalt nach dem Anspruch auf Verhinderungspflege nach § 39 Abs. 1 SGB XI. Danach sind an der Pflege gehinderte Pflegepersonen Angehörige, die in Partnerschaft lebenden Person, Nachbarn, Bekannte oder sonstige Personen, die eine pflegebedürftige Person nicht erwerbsmäßig in der Häuslichkeit pflegen (i. S. des § 19 SGB XI). Pflegekräfte einer zugelassenen ambulanten Pflegeeinrichtung nach § 72 SGB XI, Pflegekräfte, mit denen die Pflegekasse einen Einzelvertrag nach § 77 SGB XI geschlossen hat sowie Betreiber und Pflegekräfte ambulant betreuter Wohngruppen oder ambulanter Betreuungsdienste, sind keine an der Pflege gehinderten Pflegepersonen i. S. des § 39 SGB XI.
Eine Verhinderung kann wegen Urlaubs, einer Krankheit oder aus anderen Gründen der Pflegeperson bestehen. Regelmäßige Verhinderungen, z. B. eine wöchentliche Abwesenheit der Pflegeperson, führen nicht zu einem Anspruch auf Verhinderungspflege. Unter dem Begriff eines „anderen Grunds“ muss es sich um einen vergleichbar gewichtigen Grund handeln, wie es Krankheit und Erholungsurlaub darstellen. Die anderen Gründe müssen einen zeitlich begrenzten Umfang aufweisen und dürfen nicht zum regelmäßigen Pflegealltag gehören.
Im SGB XII besteht (im Gegensatz zum SGB XI) weder eine Begrenzung auf die Dauer der Verhinderung noch auf eine Leistungshöhe.
Bei einer Ersatzpflege durch Pflegepersonen, die mit der pflegebedürftigen Person bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind oder mit dieser in häuslicher Gemeinschaft leben, gilt die Regelung des § 39 Abs. 3 SGB XI analog. In diesen Fällen sind die Aufwendungen grundsätzlich auf den 1,5-fachen Betrag des Pflegegeldes des festgestellten Pflegegrades nach § 37 Abs. 1 SGB XI, bzw. § 64a Abs. 1 SGB XII beschränkt.
Zur Gruppe derer, die unter einer familienhaften Pflege nach § 64c SGB XII zu fassen sind, gehören alle Haushaltsangehörigen sowie Verwandte und verschwägerte Personen der pflegebedürftigen Person bis zum 2. Grad. Zu den Haushaltsangehörigen zählt auch der mit der pflegebedürftigen Person in häuslicher Gemeinschaft lebende Ehegatte. Verwandte bis zum zweiten Grad sind Eltern, Kinder (auch die ehelich erklärten und angenommenen Kinder), Großeltern, Enkelkinder und Geschwister. Unter dem Begriff der Verschwägerten bis zum zweiten Grad fallen Stiefeltern, Stiefkinder, Stiefenkelkinder (Enkelkinder des Ehegatten), Schwiegereltern, Schwiegerkinder (Schwiegersohn, Schwiegertochter), Schwiegerenkel (Ehegatten der Enkelkinder), Großeltern der Ehegatten, Stiefgroßeltern sowie Schwager/Schwägerin.
Erfolgt die Verhinderungspflege
ist die Zuordnung der Leistung den entsprechenden Rechtsnormen vorzunehmen (§ 64b SGB XII – Häusliche Pflegehilfe, § 64h SGB XII – Kurzzeitpflege, § 64g SGB XII – Tagespflege).
Erfolgt die Verhinderungspflege durch Pflegepersonen sind die angemessenen Aufwendungen hierfür zu übernehmen. „Angemessen“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der im Einzelfall zu bewerten ist und der gerichtlichen Prüfung vollumfänglich unterliegt. Bei einem Einsatz von Pflegepersonen des weiteren nahestehenden Personenkreises kann als angemessener Aufwand grundsätzlich der bis zum 1,5-fachen Betrag des festgestellten Pflegegrades wie bereits weiter oben beschrieben angesehen werden. Möglich im Einzelfall ist darüber hinaus die Anerkennung eines weiteren darüberhinausgehenden Aufwands, z. B. Übernahme von Fahrtkosten für die Beschreitung eines längeren Fahrtweges zur pflegebedürftigen Person.
Eine stundenweise Gewährung der Verhinderungspflege im SGB XII ist im Gegensatz zum SGB XI grundsätzlich nicht vorgesehen und bedarf einer konkreten umfangreichen Einzelfallauslegung. Bei einer länger andauernden Verhinderungspflege von über 8 Wochen im Jahr ist im Einzelfall zu prüfen, ob der pflegerische Bedarf durch die ursprünglich benannte Pflegeperson tatsächlich weiterhin sichergestellt werden kann oder ob der Einsatz einer anderweitigen Maßnahme der Hilfe zur Pflege notwendig wird.
Ein Anspruch auf Pflegehilfsmittel besteht für pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 1-5 (siehe § 63 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XII).
Die Anspruchsvoraussetzungen für die Versorgung mit notwendigen Pflegehilfsmittel sind, dass sie
Die Leistungen der Krankenversicherung im ersten Rang und nachfolgend der Pflegeversicherung sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Zuständig ist die Krankenversicherung, wenn ein Hilfsmittel den Erfolg der Krankenbehandlung sichert, eine drohende Behinderung vorbeugt oder eine Behinderung ausgleicht.
In der Regel ist der Träger der Sozialhilfe dann zuständig, wenn eine Pflegeversicherung nicht besteht. Im Einzelfall ist die Zuständigkeit der Krankenversicherung zu prüfen (auch bei den Hilfen zur Gesundheit nach § 264 SGB V).
Ein Pflegehilfsmittel muss notwendig und angemessen sein. Die Notwendigkeit ist im Einzelfall durch die Pflegefachkraft des Gesundheitsamtes festzustellen. Die Angemessenheit orientiert sich an der Leistungshöhe der Gesetzlichen Krankenversicherung und der Pflegeversicherung.
Für pflegeversicherte Menschen gibt der MD in seiner Pflegebegutachtung Empfehlungen zur Förderung der Selbstständigkeit, Prävention und Rehabilitation ab. Dazu gehören auch doppelfunktionale Hilfsmittel/Pflegehilfsmittel. Für diese Hilfsmittel gelten die Empfehlungen als Antrag bei den Kassen, sofern die antragstellende Person zustimmt. Die Notwendigkeit und Erforderlichkeit des empfohlenen Hilfsmittels wird dann nach dem SGB XI und SGB V vermutet. Es bedarf dann keiner ärztlichen Verordnung mehr. Zu den doppelfunktionalen Hilfsmitteln gehören z. B. Rollstühle, Pflegebetten, Badewannensitze, Umsetz- und Hebehilfen und Toilettensitze.
Auch Pflegefachkräfte können im Rahmen ihrer Leistungserbringung nach §§ 36 ff SGB XI sowie der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung abgeben. Die Empfehlung ist zusammen mit dem Antrag der pflegebedürftigen Person in Textform an die Pflegekasse zu übermitteln. Die Notwendigkeit der Versorgung mit dem Pflegehilfsmittel wird vermutet. In diesem Zusammenhang legt der GKV-Spitzenverband fest, in welchen Fällen und für welche Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel die Notwendigkeit der Versorgung vermutet wird. Auch regelt die Richtlinie, über welche Eignung die empfehlende Pflegefachkraft verfügen muss.
Mit der AOK Bremen/Bremerhaven wurde vereinbart, dass eine analoge Anwendung hinsichtlich der Bewilligung der Kosten für doppelfunktionale Hilfsmittel für bei dieser Kasse nach § 264 Abs. 1 und Abs. 2 SGB V betreuten Personen erfolgt. Die Empfehlung des Gesundheitsamtes ist vom Sozialdienst Erwachsene an die Krankenkasse zu senden. Von dort erfolgt die Bewilligung.
Mit anderen Kassen besteht keine Vereinbarung. Die Bewilligung des doppelfunktionalen Hilfsmittels ist dann im Einzelfall mit der jeweiligen Kasse zu klären.
Die zu diesen Regelungen gehörenden Richtlinien sind hier einsehbar:
Hilfsmittel Richtlinien GKV-Spitzenverband
Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes
Anspruchsberechtigt sind nichtversicherte Pflegebedürftige der Pflegegrade 1-5, deren pflegerische Versorgung im häuslichen Bereich sichergestellt wird.
Die Übernahme der Kosten für den Anschluss an eine Hausnotrufzentrale kommt nach ärztlicher, pflegefachlicher oder sozialpädagogischer Stellungnahme nur in Betracht, wenn
Eine Ausnahme vom obengenannten Personenkreis ist möglich, wenn durch den Anschluss an eine Hausnotrufzentrale Leistungen der Hilfe zur Pflege nicht erforderlich werden. Dies kann beispielsweise bei zusammenlebenden Ehepaaren der Fall sein, wenn ein Ehepartner bei Abwesenheit nicht unbeaufsichtigt bleiben kann und ohne Anschluss an eine Hausnotrufzentrale eine Beaufsichtigung notwendig wäre.
Der leistungsberechtigten Person sind die monatlichen Anschlusskosten an eine Hausnotrufzentrale entsprechend der Leistungshöhe im Sinne des SGB XI sowie die Anschlussgebühren zu leisten. Ist ein Telefonanschluss nicht vorhanden, sind auch die Anschlusskosten für das Telefon zu leisten.
Für leistungsberechtigte Personennach dem SGB XI werden die Kosten des Hausnotrufs von der Pflegekasse geleistet. Leistungen nach dem SGB XII für den Hausnotruf sind dann grundsätzlich nicht zu leisten.
In besonders gelagerten Einzelfällen können oberhalb der Pauschale hinausgehende Kosten für die Bereitstellung eines 24-Stunden Einsatzdienstes zur Wohnungsöffnung und zur Schlüsselhinterlegung übernommen werden. Die Voraussetzungen hierfür (Bestehen einer schweren Erkrankung in Verbindung mit dem Risiko einer Sturzgefahr und Hilflosigkeit inkl. Fehlen von Kontaktpersonen) sind zu prüfen und zu begründen.
Übernahme der monatlichen Telefon-Grundgebühr im Rahmen der Altenhilfe
In begründeten Fällen kann neben den Anschlusskosten für das Telefon aus Mitteln der Hilfe zur Pflege oder Pflege nach dem SGB XI auch die monatliche Telefon-Grundgebühr gem. § 71 Abs. 2 Nr. 6 SGB XII (Altenhilfe) übernommen werden. Die in § 71 SGB XII aufgeführten Voraussetzungen sind zu beachten. Es ist der in den Grundgebühren günstigste Anbieter zu wählen, mögliche Gebührenermäßigungen aus sozialen Gründen sind zu beachten. Die Kosten für die anfallenden Gespräche sind nicht aus Sozialhilfemitteln zu leisten.
Ein Anspruch auf Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes besteht für pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 1-5 (§ 63 Abs. 1 und Abs. 2 SGB XII).
Für die Leistung, die im Rahmen der Hilfe zur Pflege gewährt wird, gilt die Verwaltungsanweisung „Wohnungsanpassungsmaßnahmen für mobilitätsbeeinträchtigte Personen“ analog auch im Rahmen der Hilfe nach § 61 SGB XII.
Die Weisung ist im Ordner der Eingliederungshilfe in OPOS abgelegt: Verwaltungsanweisung wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
Gem. § 64f SGB XII können sogenannte „andere Leistungen“ im Rahmen der Hilfe zur Pflege bewilligt werden. Die wichtigsten Regelungen dazu werden hier vorgestellt.
In § 64f Abs. 1 SGB XII ist geregelt, dass zusätzlich zum Pflegegeld nach § 64a Abs. 1 SGB XII die Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung zu erstatten sind, soweit diese nicht anderweitig sichergestellt ist.
Auf die Vorrangigkeit der Leistungen der Pflegeversicherung nach § 44 SGB XI (Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen) wird verwiesen.
Als Erstattungsleistung kommt eine Übernahme von Beiträgen sowohl an die gesetzliche als auch an eine private Rentenversicherung in Betracht.
Allgemeine Voraussetzungen für die Möglichkeit der Erstattung von Beiträgen einer angemessenen Alterssicherung sind:
Prüfung der Angemessenheit
Sofern die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt die Prüfung der Angemessenheit der Beiträge in Hinblick auf zwei unterschiedliche Kriterien:
Zu 1.: Angemessene Höhe der Beiträge für die Alterssicherung
Hinsichtlich der angemessenen Höhe der zu übernehmenden Beiträge können die im SGB XI verankerten Regelungen herangezogen werden:
㤠44 Abs. 1 S. 1 SGB XI:
Zur Verbesserung der sozialen Sicherung der Pflegepersonen im Sinne des § 19, die einen Pflegebedürftigen Personen mit mindestens Pflegegrad 2 pflegen, entrichten die Pflegekassen Beiträge nach Maßgabe des § 166 Abs. 2 SGB VI an den zuständigen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn die Pflegeperson regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist.“
Durch die Anlehnung an § 44 SGB XI sollte die Pflegeperson grds. einen Pflegebedürftigen Personen mindestens 10 Stunden wöchentlich in der häuslichen Umgebung pflegen, bzw. nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Der zeitliche Umfang der pflegerischen Tätigkeit ist mit Hilfe der Bedarfsfeststellung/des Hilfeplanes zu ermitteln.
Hinsichtlich der Prüfung der angemessenen Beitragshöhe wird auf § 166 Abs. 2 SGB VI zurückgegriffen, womit die beitragspflichtigen Einnahmen bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen und Berücksichtigung der sogenannten jährlichen Bezugsgröße im Sinne des § 18 SGB VI definiert werden.
Die beitragspflichtigen Einnahmen als Grundlage für die Berechnung eines möglichen Beitrages zur Alterssicherung der nicht erwerbsmäßig Tätigen staffeln sich wie folgt:
Pflegegrad 2: | 27 % der jährlichen Bezugsgröße |
Pflegegrad 3: | 43 % der jährlichen Bezugsgröße |
Pflegegrad 4: | 70 % der jährlichen Bezugsgröße |
Pflegegrad 5: | 100 % der jährlichen Bezugsgröße |
Für das Jahr 2024 beträgt die jährliche Bezugsgröße im Rechtskreis West 42.420,00 € jährlich, bzw. 3.535,00 € monatlich (§ 18 SGB IV).
Beispielberechnung:
Eine pflegebedürftige leistungsberechtigte Person ist nicht pflegeversichert. Ermittelt wurde der Pflegegrad 2. Da die Pflege vollständig über die Tochter sichergestellt wird, bezieht die leistungsberechtigte Person ein Pflegegeld gem. § 64a SGB XII. Die leistungsberechtigte Person zahlt einen monatlichen Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung zur Alterssicherung der Tochter ein.
Als angemessener monatlicher (Höchst-)Beitrag würde in diesem Fall 177,53 € in Betracht kommen.
Zu 2: Angemessene Höhe der zu erwartenden Alterssicherung:
Die zu erwartende Alterssicherung ist angemessen, wenn durch sie Existenzsicherungsleistungen im Sinne des 3./4. Kapitels SGB XII vermieden werden. Kriterien für die Feststellung einer Prognose sind beispielsweise:
Die Übernahme von Beiträgen nach § 64f SGB XII scheidet aus, wenn
Ist der Ehepartner der Pflegeperson voll erwerbstätig und hat er die Wartezeit von 60 Kalendermonaten für das Altersruhegeld erfüllt, wird vermutet, dass die Altersversorgung anderweitig sichergestellt ist.
Einschätzung der voraussichtlichen Rentenhöhe
Wird im Einzelfall geltend gemacht, dass die Altersversorgung nicht sichergestellt ist, sind sowohl der Anspruch der Pflegeperson aus eigener Versicherung, soweit die Wartezeit von 60 Kalendermonaten für das Altersruhegeld bereits erfüllt ist, als auch ggf. der abgeleitete Anspruch zu berechnen. Hierfür sind die Versicherungsverläufe vorzulegen. Zur Berechnung, die von gegenwärtigen Verhältnissen ausgehen soll, kann die Amtshilfe des Versicherungssamtes in Anspruch genommen werden.
Zur Einschätzung der voraussichtlichen Rentenhöhe können über die Seite der Deutschen Rentenversicherung Online-Rechner genutzt werden.
Die Übernahme von Beiträgen für eine angemessene Alterssicherung der Pflegeperson ist eine zweckgebundene Leistung der Sozialhilfe an die pflegebedürftige Person. Es muss sichergestellt sein, dass die pflegebedürftige Person sie an die Pflegeperson weitergibt und diese zweckentsprechend verwendet wird.
Die pflegebedürftige Person hat in regelmäßigen Abständen die Entrichtung der Beiträge nachzuweisen (z. B. durch Vorlage der Einzahlungsbelege).
Es bestehen keine Bedenken, wenn die Sozialhilfedienststelle mit Zustimmung der leistungsberechtigten Person und der Pflegeperson die Beiträge direkt an den Rentenversicherungsträger überweist. Der Überweisungsträger muss die Versicherungsnummer, den Zeitraum, für den die Beträge gelten sollen, und die Aufteilung auf die abzudeckenden Monate enthalten.
Ist eine Beratung der Pflegeperson geboten, sind die Beratungskosten der Pflegeperson in angemessener Höhe zu übernehmen. Der Träger der Sozialhilfe ist zur eigenen Beratung durch qualifiziertes Personal verpflichtet. Auch hier ist der Vorrang der Pflegeversicherung zu beachten (§ 7a Pflegeberatung). Pflegebedürftige Menschen, die nicht versichert sind, erhalten die Beratung durch die am Hilfeplanverfahren beteiligten Dienste. Kosten fallen hierfür nicht an. Auch für die Beratung in den Pflegestützpunkten entstehen keine Kosten.
Die Sicherstellung der häuslichen Pflege für Pflegebedürftige im Rahmen des Arbeitsgebermodells ist im Abschnitt „Häusliche Pflegehilfe“ beschrieben: Arbeitgebermodell bei PG 2-5 (§ 64f SGB XII).
Wie im SGB XI auch haben insbesondere nichtpflegeversicherte Personen ab PG 1 einen Anspruch eine Versorgung digitaler Pflegehilfsmittel aus den Leistungen der Hilfe zur Pflege, um Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person zu mindern oder eine Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit entgegenzuwirken. Es erfolgt keine Notwendigkeitsprüfung, der Anspruch besteht dem Grunde nach.
Digitale Pflegeanwendungen können in der Häuslichkeit die Pflege sowie die pflegerische Betreuung unterstützen und entsprechen damit dem Vorrang der häuslichen Pflege. Digitale Pflegeanwendungen bestehen in vorrangig software- oder webbasierten Versorgungsangeboten, die anleitend begleiten, um Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person zu mindern und einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit entgegenzuwirken.
Der Anspruch auf digitale Pflegeanwendungen umfasst nur solche, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in das Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen nach § 78 Abs. 3 SGB XI aufgenommen sind.
Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 haben weiterhin einen Anspruch auf ergänzende Unterstützungsleistungen durch zugelassene ambulante Pflegedienste, wenn diese bei der Versorgung mit einer digitalen Pflegeanwendung im Einzelfall erforderlich ist. Die ergänzende Unterstützung kann eine erste Hilfe beim Einsatz der digitalen Pflegeanwendung umfassen, sofern die Anleitung nicht dem Hersteller obliegt.
Einzelheiten zum Anspruch auf ergänzende Unterstützungsleistungen werden durch BfArM im Rahmen des zu errichtende Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen erfasst (§ 78a Abs. 3 SGB XI).
Nach Antragstellung können anlehnend an die Regelungen des SGB XI auch im Bereich der Hilfe zur Pflege bis zu insgesamt 50,00 € monatlich für digitale Pflegeaufwendungen und ergänzende Unterstützungsleistungen gewährt werden.
Das Verzeichnis der digitalen Pflegeanwendungen ist bisher nicht veröffentlicht.
Voraussetzung für die Gewährung teilstationärer Pflege für Pflegebedürftige der PG 2-5 ist, dass die häusliche Pflege nicht ausreichend sicherzustellen ist oder die Tages- und Nachtpflege zur Ergänzung und Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Dies gilt insbesondere in den Fällen
Die Leistungen der Tages- und Nachtpflege können zusätzlich zu den Leistungen der häuslichen Pflege in Anspruch genommen werden.
Die Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege haben eine wichtige Funktion bei der Entlastung pflegender Personen. Sie sind unter aktivierenden Gesichtspunkten, bei der Versorgung und Betreuung von demenziell erkrankten Menschen, von großer Bedeutung.
Für die Leistungsdauer und Leistungshöhe einer Tages- oder Nachtpflege besteht im SGB XII keine Begrenzung.
Leistungen im Rahmen einer teilstationären Pflege
Die Pflegekasse übernimmt bei pflegeversicherten pflegebedürftigen Personen die pflegebedingten Aufwendungen der teilstationären Pflege, die Aufwendungen der sozialen Betreuung und die Fahrtkosten bis zu einer in § 41 SGB XI je nach Pflegegrad festgesetzten pauschalierten Höhe.
Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von der Pflegekasse nicht übernommen.
Nach § 64g SGB XII werden die durch die Pflegekasse nicht gedeckten Kosten (einschließlich der Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten) übernommen, wenn
Die Notwendigkeit und die Häufigkeit des Besuchs in einer teilstationären Pflege beurteilt der Sozialdienst Erwachsene im Rahmen seiner Hilfeplanung. Die Notwendigkeit wird analog der Bestimmungen im SGB XI beurteilt.
Im Rahmen der Leistungen der stationären Pflege nach § 65 SGB XII werden auch Betreuungsmaßnahmen, entsprechend § 87b SGB XI erbracht. Im Unterschied zum SGB XI, das hierzu mit dem neuen § 43b SGB XI (zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen) die Anspruchsgrundlage für alle stationären Leistungen (Kurzzeitpflege, teilstationäre Pflege) vorsieht, sind die Betreuungsmaßnahmen in der Hilfe zur Pflege nur unmittelbarer Bestandteil der stationären Pflege nach § 65 SGB XII (und deshalb nicht nach § 64g SGB XII Leistungsgrundlage für die Tages- und Nachtpflege).
Vergütungen
Die Leistungen für die Tagespflegeeinrichtung richten sich nach den abgeschlossenen Entgeltvereinbarungen nach § 75 SGB XII.
Diese Regelungen sind in der Verwaltungsanweisung Hilfe zur Pflege Teil 4 beschrieben: Kurzzeitpflege bei PG 2-5 (§ 64h SGB XII).
Der Entlastungsbetrag soll die ambulanten und teilstationären Leistungen der Pflege, bzw. Hilfe zur Pflege in der häuslichen Umgebung ergänzen. Alle pflegebedürftigen Personen mit den Pflegegraden 1-5, bei denen im häuslichen Bereich gepflegt wird, haben einen Anspruch auf den Entlastungsbetrag. Weitere Grundsätze und Unterschiede zwischen den Pflegegraden 1 und 2-5 für insbesondere nicht pflegeversicherte Pflegebedürftige werden hier vorgestellt.
Der Entlastungsbetrag nach § 64i SGB XII ist insbesondere für nicht pflegeversicherte Pflegebedürftige (zu dem berechtigten Personenkreis der Hilfe zur Pflege: Personenkreis der Hilfe zur Pflege wird verwiesen) bei PG 2-5 zu gewähren. Pflegeversicherte Personen erhalten diese Leistung seitens ihrer Pflegekasse (§ 63b Abs. 2 SGB XII). Der Entlastungsbetrag ist ausschließlich im Rahmen der häuslichen Pflege zu gewähren. Monatlich können bis zu 125,00 € im Rahmen des Entlastungsbetrages gewährt werden.
Mit dem Entlastungsbetrag sollen Pflegepersonen entlastet und pflegebedürftige Personen darin unterstützt werden, möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben. Der Entlastungsbetrag dient dem Zweck, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und unterstützend darin einzuwirken, dass der Alltag der pflegebedürftigen Person möglichst selbstständig bewältigt werden kann.
Grundsätzliche Voraussetzungen für die Gewährung des Entlastungsbetrages nach § 64i SGB XII bei Pflegegrad 2-5 stellen
Der Entlastungsbetrag ist nicht einzusetzen für die Inanspruchnahme von Leistungen nach § 64b SGB XII (häusliche Pflegehilfe) und § 64e bis § 64g SGB XII (Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen, teilstationäre Pflege).
Abweichend vom Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI für pflegeversicherte pflegebedürftige Personen ist der Entlastungsbetrag nach § 64i SGB XII für nichtpflegeversicherte pflegebedürftige Personen nicht als Erstattungsleistung formuliert. Eine Ansparmöglichkeit, wie im SGB XI, ist zusätzlich nicht möglich, da dies den sozialhilferechtlichen Grundsätzen widersprechen würde.
Der Entlastungsbetrag wird nicht auf die Leistungen nach dem 7. Kapitel des SGB XII angerechnet (§ 63b Abs. 2 SGB XII). Der angemessene und notwendige Bedarf an Hilfe zur Pflege ist entsprechend der möglichen Leistungsformen im Bereich der häuslichen Pflege vorrangig sicherzustellen, der Entlastungsbetrag wird zusätzlich im Sinne der Zweckbestimmung gewährt. Die Regelung der Nichtanrechnung gilt auch für den Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI.
Vom Sozialdienst Erwachsene ist zu bestätigen, ob der Entlastungsbetrag für die obengenannten Voraussetzungen zweckgebunden eingesetzt werden kann.
Der Entlastungsbetrag kann auch bei einem gleichbleibenden laufenden Bedarf im Sinne der Zweckbestimmung als laufende Leistung ausgezahlt werden.
Die Verwendung ist nachzuweisen.
Der Entlastungsbetrag nach § 66 SGB XII ist insbesondere für nichtpflegeversicherte pflegebedürftige Personen (zu dem berechtigten Personenkreis der Hilfe zur Pflege: Personenkreis der Hilfe zur Pflege wird verwiesen) zu gewähren. Pflegeversicherte Personen enthalten diese Leistung von der Pflegekasse (§ 63b Abs. 2 SGB XII).
Pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 1 haben einen eingeschränkten Zugriff auf die Leistungsformen der Hilfe zur Pflege. Teil des möglichen Leistungsumfangs stellt der Entlastungsbetrag dar.
Der Entlastungsbetrag ist ausschließlich im Rahmen der häuslichen Pflege zu gewähren. Monatlich können bis zu 125,00 € im Rahmen des Entlastungsbetrages gewährt werden. Mit dem Entlastungsbetrag sollen Pflegepersonen entlastet und pflegebedürftige Personen darin unterstützt werden, möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben. Der Entlastungsbetrag dient dem Zweck, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und unterstützend darin einzuwirken, dass der Alltag der pflegebedürftigen Person möglichst selbstständig bewältigt werden kann.
Grundsätzliche Voraussetzungen für die Gewährung des Entlastungsbetrages nach § 66 SGB XII bei Pflegegrad 1 stellen
In der Gesetzesbegründung werden die Regelungen des Entlastungsbetrages für Pflegebedürftige des PG 1 wie folgt beschrieben:
„Im Hinblick darauf, dass die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Sinne des § 61a bei Personen mit Pflegegrad 1 gering ausgeprägt sind, werden die Leistungen der Hilfe zur Pflege - wie auch im vorrangigen System der sozialen Pflegeversicherung - grundsätzlich für die Pflegegrade 2 bis 5 gewährt (vgl. § 28a SGB XI). Aus pflegewissenschaftlicher Sicht ist ein uneingeschränkter Zugang zu den Leistungen der Hilfe zur Pflege bei Pflegebedürftigen Personen des Pflegegrades 1 nicht angezeigt. Das Siebte Kapitel greift diesen Vorschlag insoweit auf, als dem Personenkreis der pflegebedürftigen Personen mit Pflegegrad 1 ein Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich gewährt wird. Der Entlastungsbetrag soll die pflegebedürftige Person des Pflegegrades 1 befähigen, möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben zu können; dementsprechend ist der Entlastungsbetrag im Sinne des Satz 2 Nummer 1 bis 4 zweckgebunden einzusetzen. Auf diesem Wege wird sichergestellt, dass nichtversicherte pflegebedürftige Personen die gleichen Leistungen wie pflegebedürftige Personen erhalten, die Mitglied der sozialen Pflegeversicherung sind.“
Der Entlastungsbetrag nach § 66 SGB XII ist für die im Gesetz beschriebenen Zwecke einzusetzen. Diese Zweckbestimmung ist gegenüber dem Entlastungsbetrag für die Pflegegrade 2-5 erweitert und kann unter anderem auch für eine häusliche Pflegehilfe (Pflegedienst, ambulanter Betreuungsdienst) nach § 64b SGB XII und der teilstationären Pflege (Tagespflege) nach § 64g SGB XII eingesetzt werden.
Der Entlastungsbetrag wird nicht auf die Leistungen nach dem 7. Kapitel des SGB XII angerechnet (§ 63b Abs. 2 SGB XII). Die Regelung der Nichtanrechnung gilt auch für den Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI.
Vom Sozialdienst Erwachsene ist zu bestätigen, ob der Entlastungsbetrag im Rahmen der obengenannten Voraussetzungen zweckgebunden eingesetzt werden kann.
Der Entlastungsbetrag kann auch bei einem gleichbleibenden laufenden Bedarf im Sinne der Zweckbestimmung als laufende Leistung ausgezahlt werden.
Die Verwendung ist nachzuweisen.
Sofern der notwendige Bedarf über den Entlastungsbetrag für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 1 nicht sichergestellt werden kann, können weitere Maßnahmen nach dem 9. Kapitel SGB XII gewährt werden. Voraussetzung für eine Ergänzung der Leistungen unter anderem ist, dass der Entlastungsbetrag zweckidentisch eingesetzt wird. Zu den im Pflegegrad 1 ergänzenden Maßnahmen gehören:
Bei einer Gewährung ergänzender Leistungen körperbezogener Pflegemaßnahmen können sowohl notwendige körperbezogene Pflegemaßnahmen als auch pflegerische Betreuungsmaßnahmen (Leistungskomplexe 26/27) auch in Verbindung mit Hilfen bei der Haushaltsführung in Betracht kommen. Voraussetzung für eine Bewilligung nach dem 9. Kapitel SGB XII ist, dass der von der Pflegekasse oder dem Sozialhilfeträger bewilligte Entlastungsbetrag in Höhe von 125 € zunächst für die körperbezogenen Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen) und/oder den Hilfen bei der Haushaltsführung eingesetzt wird. Sofern die Höhe des Entlastungsbetrages nicht ausreicht, um den notwendigen Bedarf zu decken, sind die körperbezogenen Pflegemaßnahmen, die pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung unter Beachtung o. g. Rechtsgrundlagen zu bewilligen. Sollten körperbezogene Pflegemaßnahmen/pflegerische Betreuungsmaßnahmen in Verbindung mit Hilfen bei der Haushaltsführung notwendig sein, sind diese Bedarfe in Gänze nach § 73 SGB XII zu gewähren. Hinsichtlich der Notwendigkeit ist das standardisierte Verfahren zur Bedarfsfeststellung anzuwenden.
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen und Maßnahmen zur sozialen Teilhabe im Rahmen der Altenhilfe schließen sich in der Regel gegenseitig aus.
Übersicht ergänzende Maßnahmen PG 1
Seitens der Dienstleistungszentren werden sogenannte „Alltagsassistenten/innen“ eingesetzt, wodurch im Rahmen der „Verordnung über die Anerkennung und Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach dem SGB XI für das Land Bremen“ auch niedrigschwellige Angebote zur Unterstützung im Alltag gem. § 45a SGB XI unterbreitet werden können.
Um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können, kann der jeweilige individuelle Entlastungsbetrag eingesetzt werden. Im Rahmen des Einsatzes von Alltagsassistenten/innen fallen monatlich 35,00 € an Service-Pauschale sowie 9,50 € je geleisteter Stunde an. Fahrtkosten werden nicht berücksichtigt.
Die Pflegekasse leistet die o. g. Service-Pauschale nur, wenn auch seitens der DLZ eine Alltagsassistenz in einem Monat eingesetzt ist. Eine Erstattung der Service-Pauschale durch die Pflegekasse kann beispielsweise entfallen, wenn für den gesamten Monat wegen z. B. eines Krankenhausaufenthalts, einer Rehabilitation oder Kurzzeitpflege keine Alltagsassistenz geleistet wurde. Für leistungsberechtigte Personen nach dem SGB XII kann in diesem Sachverhalt die Service-Pauschale im Rahmen der Hilfe zur Pflege, bzw. ergänzender Leistungen nach dem 9. Kapitel des SGB XII (für pflegebedürftige Personen mit Pflegegrad 1) gewährt werden.
Der Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI stellt eine Erstattungsleistung dar. Dies bedeutet, dass die leistungsberechtigte Person die jeweilige monatliche Rechnungssumme vorauszahlen und sich diese Aufwendungen sodann seitens der Pflegekasse erstatten lassen müssen. Vereinzelte Pflegekassen haben diesbezüglich abweichende Regelungen. Das Erstattungsverfahren als solches kann beispielsweise bei leistungsberechtigte Personen mit Transferleistungen oder bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu Problemen führen. Eine generelle Lösung dieser Problematik ist wegen der Individualität nicht möglich. In diesen Einzelfällen sind deshalb nach Möglichkeit Unterstützungsbedarfe zwischen den Leitungen der Dienstleistungszentren und dem Sozialdienst Erwachsene zu finden und zu regeln. Dieses gilt insbesondere für Menschen mit einem Pflegegrad 1, weil der Entlastungsbetrag für ergänzende Leistungen nach dem 9. Kapitel des SGB XII zweckidentisch einzusetzen ist.
Ziel der Ambulanten Maßnahme Persönliche Assistenz (ISB)
Die Ambulante Maßnahme Persönliche Assistenz (ISB) ist ein individuelles Leistungssetting im eigenen Wohnraum sowie im Sozialraum der leistungsberechtigten Person. In diesem Setting wird den leistungsberechtigten Personen ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben, sowie eine individuelle Lebensführung gewährleistet. Unterschiedliche Unterstützungsbedarfe, wie pflegerische Bedarfe (körperbezogene Pflegemaßnahmen, hauswirtschaftliche Verrichtungen) und Bedarfe zur Sozialen Teilhabe (Assistenzleistungen) werden durch eine Assistenzkraft während eines Einsatzes vor Ort flexibel geleistet. Dies gewährleistet eine umfassende und bedarfsgerechte Leistungserbringung „aus einer Hand“. Die Dienstleistung vor Ort beinhaltet demnach sowohl ein Kontingent an Pflegeleistungen als auch ein Kontingent an Teilhabeleistungen, die gebündelt, flexibel und bedarfsgerecht aus einer Hand erbracht werden. Sie ist insofern eine besondere Dienstleistung in einem besonderen Setting.
Zielgruppen
Die ISB ist eine ambulante Leistung für pflegebedürftige Menschen im Sinne der oben genannten Zielsetzung. Sie umfasst sämtliche Hilfestellungen bei Verrichtungen des Alltags, die die leistungsberechtigte Person für eine (möglichst) selbstbestimmte Lebensführung in einem selbstgewählten Wohnumfeld benötigt und die dem Grunde nach von den betroffenen Menschen selbst eingefordert und angeleitet werden können. Die Verrichtungen beziehen sich auf Pflege, Hauswirtschaft und Eingliederungshilfe. Innerhalb der ISB liegt das Direktionsrecht bei der leistungsberechtigten Person.
Eine pädagogische oder therapeutische Hilfe durch die Assistentinnen und Assistenten ist nicht vorgesehen.
Der Zugang zur ISB setzt voraus, dass das Direktionsrecht auch in sinnvoller Weise ausgeübt werden kann. Dies ist der Fall, wenn die leistungsberechtigte Person selbst über genügend Anleitungs- und Alltagskompetenz verfügen, um selbstständig anzuleiten und/oder geeignete sonstige Maßnahmen getroffen werden können, die gewährleisten, dass die ISB im Sinne des Willens der Leistungsberechtigter Person erfolgt.
Die Fähigkeiten der Anleitungskompetenz und die Form des Ausdrucks dieser Fähigkeiten sind bei allen Menschen unterschiedlich und unterliegen Entwicklungen. Die Kompetenzen sind hier in dem Sinne der individuellen Willensäußerung zu sehen. Das Nachlassen der Fähigkeiten führt nicht zu einem Ausschluss aus der Maßnahme ISB.
Diese Fähigkeiten – verbunden mit der Eingraduierung in den Pflegegraden 3-5 – charakterisieren den Zugang zur Leistung ISB. Für Menschen, deren Pflegebedürftigkeit nach dem Pflegegrad 2 festgestellt wurde, ist die Leistung ISB geöffnet. Für den Pflegegrad 1 ist eine Maßnahme des ISB ausgeschlossen.
Liegt ausreichende Anleitungskompetenz vor bzw. ist die Ausübung des Direktionsrechts in anderer Weise sichergestellt, können Menschen auf Wunsch ISB erhalten, bei denen der Pflegegrad 2 im Sinne des SGB XI vorliegt. Dies gilt insbesondere dann,
Die Maßnahme wird im Einzelfall durch den Sozialdienst Erwachsene getroffen.
Gesetzliche Grundlagen
Die ISB stellt eine ambulante Hilfe zur Pflege im Sinne der §§ 61ff SGB XII sowie Eingliederungshilfe als Assistenzleistungen zur Sozialen Teilhabe gem. §§ 113 Abs. 2 Nr. 2, 78 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und § 78 Abs. 6 SGB IX dar.
Die Leistungen der ISB können auch als Persönliches Budget nach § 29 SGB IX erbracht werden. Sie können auch als „Arbeitgebermodell“ nach § 64f Abs. 3 SGB XII ausgeführt werden.
Träger der ISB
Leistungen der ISB bieten folgende Träger an:
Die Träger leisten ISB auf der Grundlage von Leistungs- und Entgeltvereinbarungen gem. § 89 SGB XI sowie § 75 SGB XII, bzw. §§ 125 ff SGB IX. Die Leistungsentgelte pro Stunde werden durch die Verträge festgelegt.
Art und Umfang der Hilfe
Die ISB umfasst die persönliche Assistenz behinderter Menschen in und außerhalb der eigenen Wohnung. Sie wird durch Assistentinnen und Assistenten, die bei den Trägern angestellt sind, geleistet. Bei allen drei Trägern sind Pflegedienstleitungen tätig, die Pflegefachkräfte im Sinne des SGB XI sind, und die die Qualitätssicherung aus pflegefachlicher Sicht gewährleisten.
Die Assistentinnen und Assistenten werden durch die Träger fortgebildet. Die Fortbildung ist im Leistungsentgelt enthalten.
Regelmäßige Elemente der Hilfeleistung sind:
Die Assistenzleistungen zur Sozialen Teilhabe umfassen auch die notwendige Präsenz der Assistenzkraft zusätzlich zum festgestellten Pflegebedarf. Die Notwendigkeit einer Präsenz der Assistenzkraft ist durch die Fachkräfte des SDE festzustellen.
Leistungen für pflegerische Betreuungsmaßnahmen sind neben den Leistungen zur Sozialen Teilhabe ausgeschlossen.
Bedarfsfeststellung
Die in dieser Verwaltungsanweisung getroffenen Regelungen zum Bedarfsfeststellungsverfahren und Erstellen eines Hilfeplanes gelten auch für Leistungen der ISB.
Ergänzend ist die Fachliche Mitteilung „Rechtliche Bedarfszuordnung im Leistungssetting Ambulante Maßnahme Persönliche Assistenz (ISB)“ vom 06.12.2022 heranzuziehen: rechtliche Bedarfszuordnung im Leistungssetting ISB.
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach § 98 Abs. 6 SGB XII i. V. m. § 98 SGB IX.
Allgemeines
Die Paritätischen Dienste Bremen gGmbH bieten in folgenden Häusern einen besonderen Service:
• | Weidedamm | Ricarda- |
• | Kattenturm | Alfred- |
• | Viertel | Seilerstraße 13 |
Unter der Bezeichnung „Akzent–Wohnen“ ist eine Rund-um-die-Uhr-Versorgungssicherheit für erwachsene Menschen mit körperlicher Behinderung und Pflegebedarf zu verstehen. Die Versorgungssicherheit wird durch einen Bereitschaftsdienst innerhalb der Häuser mit besonderem Service gewährleistet. Zugleich wird die notwendige häusliche Pflege- und Eingliederungshilfe in der eigenen Wohnung erbracht.
Rechtsgrundlage
Es handelt sich um eine Leistung der ambulanten Hilfe zur Pflege nach §§ 61 SGB XII ff. sowie Eingliederungshilfe, Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Assistenzleistungen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 2, 78 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 SGB IX.
Ziel und Zielgruppe
Akzent-Wohnen ist ein Angebot an erwachsene Menschen mit körperlicher Behinderung und Pflegebedarf (Pflegegrade 3-5), die einen Bedarf an rollstuhlgerechten Wohnraum haben. Sie können durch die Rund-um-die-Uhr-Versorgungssicherheit in der eigenen Wohnung leben und verfügen über genügend Kompetenz, die Pflegekräfte selbständig anzuleiten. Die behinderten Menschen müssen zu einer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung in der Lage sein, d. h. ihre Hilfeleistungen verantwortlich abrufen und einsetzen sowie ihr soziales Umfeld eigenständig gestalten. Ebenso muss ein behinderungsbedingter Bedarf an einer Rund-um-die-Uhr-Versorgungssicherheit vorhanden sein, ohne dass die ständige Anwesenheit von Pflegekräften erforderlich ist.
Akzent – Wohnen soll den Menschen mit körperlicher Behinderung und Pflegebedarf ein selbstbestimmtes Leben im Rahmen der eigenen Wohnumgebung eröffnen und stationäre Versorgung vermeiden oder herauszögern helfen bzw. einen Wechsel aus der stationären in eine ambulante Versorgungsform ermöglichen. Der anspruchsberechtigte Personenkreis wohnt daher vor dem Einzug in das Akzentmodell
Sofern behinderte Menschen beabsichtigen, aus dem elterlichen Haushalt in ein Servicehaus zu ziehen, ist seitens des Sozialdienstes die familiäre Situation zur Frage, ob die Pflege weiterhin durch die Eltern sichergestellt werden kann, umfassend zu beurteilen. Dabei ist u. a. auch festzustellen, ob unterstützende Hilfeleistungen ausreichend sein können und welche alternativen Unterbringungsmöglichkeiten zum Akzent-Wohnen gegeben sind.
Bei behinderten Menschen, die mit einer/einem nicht behinderten Partner*in gemeinsam eine Wohnung im Rahmen von Akzent beziehen wollen, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der Bedarf an Rund-um-die-Uhr-Versorgungssicherheit durch diese/diesen gedeckt ist. Folglich kann ein Einzug unter diesen Umständen nur in besonders begründeten Einzelfällen erfolgen.
Art und Umfang der Hilfe
Die Hilfe in den Häusern mit besonderen Service wird in und außerhalb der eigenen Wohnung gleistet.
Häusliche Pflegeleistungen nach § 36 SGB XI und Häusliche Pflegehilfe nach § 64b SGB XII
Die Leistungsgewährung wird nach Leistungskomplexen vorgenommen. Sie werden vom Pflegedienst der Paritätischen Dienste angeboten, der direkt in den Häusern mit besonderen Service untergebracht ist.
Für die Hilfegewährung gelten folgende Besonderheiten:
Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Assistenzleistungen gem. §§ 113 Abs. 2 Nr. 2, 78 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 SGB IX.
Die Assistenzleistungen zur Sozialen Teilhabe umfassen insbesondere die Gestaltung sozialer Beziehungen, die Teilhabe am gemeinschaftlichen, kulturellen und politischen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten, die Sicherstellung der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.
Leistungen für pflegerische Betreuungsmaßnahmen sind neben den Assistenzleistungen zur Sozialen Teilhabe ausgeschlossen.
Bereitschaftsdienst im Akzent-Wohnen (kurzfristige Hilfen im sozialpflegerischen Sinne)
Der Bereitschaftsdienst im Akzent-Wohnen erbringt ergänzend zu den durch den Pflegedienst des PGSW nach Leistungskomplexen erbrachten Leistungen unverzügliche Hilfeleistungen bei spontan auftretenden Bedarfen. Bei diesen kurzfristigen Hilfen kann es sich z. B. um die Leistungskomplexe 9 und 10 sowie Notrufe (z. B. bei epileptischen oder spastischen Anfällen, MS-Schüben) handeln. Darüber hinaus gewährleistet der Bereitschaftsdienst eine Rund-umdie-Uhr-Versorgungssicherheit.
Nach einer Vereinbarung gem. § 75 SGB XII ist das Pauschalentgelt für den Bereitschaftsdienst veröffentlicht.
Der PGSW hat die Möglichkeit, auch behinderten Menschen in der näheren Umgebung der Häuser mit besonderen Service die Leistungen des Bereitschaftsdienstes zum vereinbarten Entgelt anzubieten.
Sonstiges
Bei Anträgen auf Übernahme der Kosten für eine behindertengerechte Küche ist ggf. auf die vorrangigen Leistungen der Pflegekassen gem. § 40 Abs. 4 SGB XI (Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes) zu verweisen.
Kostenübernahme
Die Wirtschaftlichen Hilfen entscheiden nach Vorlage
Dem Vorrang ambulanter Hilfen vor stationären Maßnahmen im Sinne der § 13 SGB XII soll bei der Hilfegewährung Rechnung getragen werden.
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach § 98 Abs. 6 SGB XII i. V. m. § 98 SGB IX.
In einer Pflegewohngemeinschaft leben mehrere pflegebedürftige Menschen zusammen. Jede Person verfügt über ein eigenes Zimmer oder Appartement. Daneben gibt es gemeinschaftlich genutzte Räume (wie beispielsweise die Küche), die von allen Bewohnern genutzt werden können.
Pflege-Wohngemeinschaften stellen ein ambulantes Leistungsangebot für Menschen dar, die einen Unterstützungsbedarf haben und in der eigenen Häuslichkeit nicht verbleiben können. Der Alltag der pflegebedürftigen Personen kann besser bewältigt werden, indem Betreuungs- und Unterstützungsangebote gemeinsam genutzt werden. Diesbezüglich wird eine Person beauftragt, die organisatorische, verwaltende oder betreuende Tätigkeiten übernimmt sowie im Haushalt unterstützt (Präsenzkraft). Die Finanzierung für die beauftragte Person erfolgt aus Mitteln der Pflegekassen durch Gewährung des Wohngruppenzuschlages von derzeit 214,00 € gem. § 38 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI. Zusätzlich fördert die Pflegeversicherung durch eine Anschubfinanzierung die Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen. Die Zahlung der Leistung setzt voraus, dass mindestens drei und höchstens 12 pflegebedürftige Personen in einer gemeinsamen Wohnung zum Zweck der gemeinschaftlich organisierten pflegerischen Versorgung zusammenleben. Das Zusammenleben innerhalb eines Familienverbandes verfolgt diesen Zweck der gemeinschaftlichen pflegerischen Versorgung nach dem Willen des Gesetzgebers nicht.
Bei der im Sinne von § 38a Abs. 1 Nr. 3 SGB XI beauftragten Person muss es sich um eine ausgebildete Pflegefachkraft handeln. Die Dauer der Tätigkeit der beauftragten Person ist nicht beschrieben, eine Rufbereitschaft ist aber nicht ausreichend.
Der Anspruch setzt voraus, dass die freie Wählbarkeit der Pflege- und Betreuungsleistungen rechtlich und tatsächlich nicht eingeschränkt sind. Um eine ambulant betreute Wohngruppe handelt es sich nicht, wenn eine Versorgungsform vorliegt, in denen Leistungen angeboten bzw. gewährleistet werden, die denen im Rahmenvertrag für die vollstationäre Pflege vereinbarten Leistungsumfang entsprechen.
Es wird unterschieden zwischen anbieterorganisierte und selbstorganisierte Pflegewohngemeinschaften. Für anbieterorganisierte Pflege-Wohngemeinschaften sind die Vorschriften des Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetzes zu berücksichtigen. Anbieterorganisierte Pflege-Wohngemeinschaften sind vor Inbetriebnahme bei der Wohn- und Betreuungsaufsicht anzuzeigen.
Bei den Pflege-Wohngemeinschaften handelt es sich um eine ambulant betreute Wohnmöglichkeit im Sinne des § 98 Abs. 5 SGB XII.
Personenkreis
Zugangsvoraussetzungen zu einer Pflege-Wohngemeinschaft verbunden mit der Möglichkeit der Finanzierung im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII sind:
Die Prüfung der Angemessenheit und Zumutbarkeit richtet sich nach §§ 9 und 13 SGB XII. Die Notwendigkeit zum Zugang in eine Pflege-Wohngemeinschaft wird durch den Sozialdienst Erwachsene festgestellt. Eine Prüfung kann bestenfalls jedoch nur erfolgen, wenn vor einem Zuzug in eine Pflege-Wohngemeinschaft Kontakte zum Sozialhilfeträger bestanden und eine entsprechende Beratung möglich gewesen ist.
Pflege-Wohngemeinschaften mit abgeschlossenen Entgeltvereinbarungen
Anzuwenden ist die nachfolgende Regelung auf die Leistungsanbieter, die für ihre Pflege-Wohngemeinschaften Entgeltvereinbarungen zu sogenannten „Betreuungsleistungen“ mit dem Sozialhilfeträger Bremen geschlossen haben. Grundsätzlich werden diese Entgeltvereinbarungen nur bezogen auf anbieterorganisierte Pflegewohngemeinschaften geschlossen.
Folgende Leistungen der Pflege/Hilfe zur Pflege können in diesem Zusammenhang bewilligt werden:
Seitens der Pflegeversicherung werden Pflegesachleistungen in pauschalierter Höhe je nach Pflegegrad entsprechend § 36 SGB XI bewilligt. Für insbesondere nichtpflegeversicherte Pflegebedürftige ist die Leistung analog des § 36 SGB XI im Umfang des entsprechenden Pflegegrades zu gewähren (§ 64b SGB XII).
Zusätzlich zu den Pflegesachleistungen können im Rahmen der häuslichen Pflegehilfe nach § 64b SGB XII die mit dem Leistungsanbieter vereinbarten Betreuungsleistungen gewährt werden. Die Betreuungsleistungen beinhalten insbesondere:
Für die Betreuungsleistungen ist ein tägliches Entgelt vereinbart. Der Monatsbetrag ist mit 30,42 zu rechnen.
Die Regelungen zur vorübergehenden Abwesenheit oder zur Beendigung der Betreuungsleistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung bzw. dem Vertrag.
Im Entgelt ist die Leistung der Pflegekasse gem. § 38a SGB XI (Wohngruppenzuschlag) bereits berücksichtigt und nicht in Abzug zu bringen. Für insbesondere nichtpflegeversicherte Pflegebedürftige ist diese Leistung analog § 38a SGB XI im Rahmen des § 64b SGB XII zu gewähren.
Neben den Betreuungsleistungen besteht ein Anspruch auf ein bis zu 2/3 gekürztes Pflegegeld (§§ 63b Abs. 5, 64a SGB XII): Gekürztes Pflegegeld (§ 63b Abs. 5 SGB XII).
Die Leistungen für die Angebote zur Unterstützung im Alltag in Form des Entlastungsbetrages nach § 45b SGB XI bzw. für insbesondere nichtpflegeversicherte Pflegebedürftige nach § 64i SGB XII bleiben unberücksichtigt.
Etwaige zusätzliche Leistungen für die Reinigung des Zimmers, die Reinigung der Wäsche und Investitionskosten werden nicht zusätzlich im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII übernommen. Sie sind von den pflegebedürftigen Personen als Eigenanteil zu erbringen.
Die Bestimmungen des Elften Kapitels des SGB XII (Einsatz von Einkommen und Vermögen) finden entsprechende Anwendung.
Neben den Leistungen der Hilfe zur Pflege kann bei geringem Einkommen und Vermögen ein Anspruch auf existenzsichernde Leistungen nach den entsprechenden Bestimmungen des SGB XII bestehen. Für den Regelbedarf ist die Regelbedarfsstufe 1 anzuwenden.
Verfahren:
Die Betreuungsleistungen sind in der Regel für die Dauer des Bewilligungszeitraumes (die Regelbewilligungszeitraum in der Hilfe zur Pflege beträgt 2 Jahre) an den Leistungsanbieter auszuzahlen. Über die Bewilligungsdauer und Höhe der Leistung (ggf. nach Abzug eines einzusetzenden Einkommens als Eigenanteil), erhält der Leistungsanbieter eine Kostenzusicherung.
Pflege-Wohngemeinschaften ohne abgeschlossenen Entgeltvereinbarungen
Für Pflege-Wohngemeinschaften ohne abgeschlossene Entgeltvereinbarungen (dazu zählen meist auch selbstorganisierte Pflegewohngemeinschaften) zu den sogenannten „Betreuungsleistungen“ ist eine Bedarfsermittlung sowie Bewilligung des Bedarfes im Rahmen der Hilfe zur Pflege entsprechend der in dieser Verwaltungsanweisung beschriebenen Regelungen durchzuführen (u. a. Bedarfsfeststellungs- und Hilfeplanverfahren). Neben den Leistungen der Hilfe zur Pflege können existenzsichernde Leistungen gem. des 3./4. Kapitels des SGB XII in Betracht kommen. Die Einkommens- und Vermögensregelungen des SGB XII sind zu beachten.
Pflege-Wohngemeinschaften außerhalb des Landes Bremen
Außerhalb des Landes Bremens gelten die im jeweiligen Bundesland getroffenen Regelungen und Vereinbarungen.
Die Sorglos GbR bietet anbieterverantwortete Wohngemeinschaften zu folgenden Adressen an:
Da für die Pflegewohngemeinschaften keine Entgeltvereinbarung geschlossen wurde, gelten die oben aufgeführten Regelungen (u. a. Durchführung eines individuellen Bedarfsfeststellungs- und Hilfeplanverfahren).
Die Deckung des hauswirtschaftlichen Bedarfs erfolgt durch eigens eingestellte Kräfte (Pflegepersonen). Mit Stand 01/2024 wird hierfür ein Stundenlohn in Höhe von 15,37 € anerkannt. Für die pflegerischen Bedarfe körperbezogene Pflege und Betreuung und Aktivierung können die notwendigen Leistungen durch Einsatz eines Pflegedienstes gewährt werden.
Durch das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz vom 23.10.2020 wurde mit Wirkung zum 29.10.2020 die neue Vorschrift des § 37c in das SGB V eingeführt:
§ 37c Außerklinische Intensivpflege
(1) Versicherte mit einem besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege haben Anspruch auf außerklinische Intensivpflege. Ein besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege liegt vor, wenn die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich ist. Der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege umfasst die medizinische Behandlungspflege, die zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich ist, sowie eine Beratung durch die Krankenkasse, insbesondere zur Auswahl des geeigneten Leistungsorts nach Abs. 2. Die Leistung bedarf der Verordnung durch eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt, die oder der für die Versorgung dieser Versicherten besonders qualifiziert ist. Die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt hat das Therapieziel mit der versicherten Person zu erörtern und individuell festzustellen, bei Bedarf unter Einbeziehung palliativmedizinischer Fachkompetenz. Bei Versicherten, die beatmet werden oder tracheotomiert sind, sind mit jeder Verordnung einer außerklinischen Intensivpflege das Potenzial zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung und Dekanülierung sowie die zu deren Umsetzung notwendigen Maßnahmen zu erheben, zu dokumentieren und auf deren Umsetzung hinzuwirken. Zur Erhebung und Dokumentation nach Satz 6 sind auch nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärztinnen oder Ärzte/Ärztinnen oder nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Krankenhäuser berechtigt; sie nehmen zu diesem Zweck an der vertragsärztlichen Versorgung teil. Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nummer 6 bis zum 31. Oktober 2021 jeweils für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, für junge Volljährige, bei denen ein Krankheitsbild des Kinder- und Jugendalters weiterbesteht oder ein typisches Krankheitsbild des Kinder- und Jugendalters neu auftritt oder ein dem Kindesalter entsprechender psychomotorischer Entwicklungsstand vorliegt, und für volljährige Versicherte getrennt das Nähere zu Inhalt und Umfang der Leistungen sowie die Anforderungen
1. an den besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege nach Satz 2,
2. an die Zusammenarbeit der an der medizinischen und pflegerischen Versorgung beteiligten ärztlichen und nichtärztlichen Leistungserbringer, insbesondere zur Sicherstellung der ärztlichen und pflegerischen Versorgungskontinuität und Versorgungskoordination,
3. an die Verordnung der Leistungen einschließlich des Verfahrens zur Feststellung des Therapieziels nach Satz 5 sowie des Verfahrens zur Erhebung und Dokumentation des Entwöhnungspotenzials bei Versicherten, die beatmet werden oder tracheotomiert sind und
4. an die besondere Qualifikation der Vertragsärztinnen oder VertragsÄrzte/Ärztinnen, die die Leistung verordnen dürfen.
(2) Versicherte erhalten außerklinische Intensivpflege
1. in vollstationären Pflegeeinrichtungen, die Leistungen nach § 43 des Elften Buches erbringen,
2. in Einrichtungen im Sinne des § 43a Satz 1 in Verbindung mit § 71 Abs. 4 Nummer 1 des Elften Buches oder Räumlichkeiten im Sinne des § 43a Satz 3 in Verbindung mit § 71 Abs. 4 Nummer 3 des Elften Buches,
3. in einer Wohneinheit im Sinne des § 132l Abs. 5 Nummer 1 oder
4. in ihrem Haushalt oder in ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, in Schulen, Kindergärten und in Werkstätten für behinderte Menschen.
Berechtigten Wünschen der Versicherten ist zu entsprechen. Hierbei ist zu prüfen, ob und wie die medizinische und pflegerische Versorgung am Ort der Leistung nach Satz 1 sichergestellt ist oder durch entsprechende Nachbesserungsmaßnahmen in angemessener Zeit sichergestellt werden kann; dabei sind die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände zu berücksichtigen. Über die Nachbesserungsmaßnahmen nach Satz 3 schließt die Krankenkasse mit der versicherten Person eine Zielvereinbarung, an der sich nach Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs weitere Leistungsträger zu beteiligen haben. Zur Umsetzung der Zielvereinbarung schuldet die Krankenkasse nur Leistungen nach diesem Buch. Die Feststellung, ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 und den Sätzen 1 bis 3 erfüllt sind, wird durch die Krankenkasse nach persönlicher Begutachtung des Versicherten am Leistungsort durch den Medizinischen Dienst getroffen. Die Krankenkasse hat ihre Feststellung jährlich zu überprüfen und hierzu eine persönliche Begutachtung des Medizinischen Dienstes zu veranlassen. Liegen der Krankenkasse Anhaltspunkte vor, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 und den Sätzen 1 bis 3 nicht mehr vorliegen, kann sie die Überprüfung nach Satz 7 zu einem früheren Zeitpunkt durchführen. Ist die Feststellung nach Satz 6 oder die Überprüfung nach den Sätzen 7 und 8 nicht möglich, weil der oder die Versicherte oder eine andere an den Wohnräumen berechtigte Person sein oder ihr Einverständnis zu der nach den Sätzen 6 bis 8 gebotenen Begutachtung durch den Medizinischen Dienst in den Wohnräumen nicht erteilt hat, so kann in den Fällen, in denen Leistungen der außerklinischen Intensivpflege an einem Leistungsort nach Satz 1 Nummer 3 oder Nummer 4 erbracht oder gewünscht werden, die Leistung an diesem Ort versagt und der oder die Versicherte auf Leistungen an einem Ort im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 oder Nummer 2 verwiesen werden.
(3) Erfolgt die außerklinische Intensivpflege in einer vollstationären Pflegeeinrichtung, die Leistungen nach § 43 des Elften Buches erbringt, umfasst der Anspruch die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für die Betreuung und die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege in der Einrichtung unter Anrechnung des Leistungsbetrags nach § 43 des Elften Buches, die betriebsnotwendigen Investitionskosten sowie die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung nach § 87 des Elften Buches. Entfällt der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege auf Grund einer Besserung des Gesundheitszustandes, sind die Leistungen nach Satz 1 für sechs Monate weiter zu gewähren, wenn eine Pflegebedürftigkeit des Pflegegrades 2, 3, 4 oder 5 im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 4 Nummer 2 bis 5 des Elften Buches festgestellt ist. Die Krankenkassen können in ihrer Satzung bestimmen, dass die Leistungen nach Satz 1 unter den in Satz 2 genannten Voraussetzungen auch über den in Satz 2 genannten Zeitraum hinaus weitergewährt werden.
(4) Kann die Krankenkasse keine qualifizierte Pflegefachkraft für die außerklinische Intensivpflege stellen, sind der versicherten Person die Kosten für eine selbstbeschaffte Pflegefachkraft in angemessener Höhe zu erstatten. Die Möglichkeit der Leistungserbringung im Rahmen eines persönlichen Budgets nach § 2 Abs. 2 Satz 2, § 11 Abs. 1 Nummer 5 des Fünften Buches in Verbindung mit § 29 des Neunten Buches bleibt davon unberührt.
(5) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung an die Krankenkasse den sich nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag, begrenzt auf die ersten 28 Kalendertage der Leistungsinanspruchnahme je Kalenderjahr. Versicherte, die außerklinische Intensivpflege an einem Leistungsort nach Abs. 2 Satz 1 Nummer 4 erhalten und die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung an die Krankenkasse abweichend von Satz 1 den sich nach § 61 Satz 3 ergebenden Betrag, begrenzt auf die für die ersten 28 Kalendertrage der Leistungsinanspruchnahme je Kalenderjahr anfallenden Kosten.
(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt über das Bundesministerium für Gesundheit dem Deutschen Bundestag bis Ende des Jahres 2026 einen Bericht über die Erfahrungen mit der Umsetzung des Anspruchs auf außerklinische Intensivpflege vor. Darin sind insbesondere aufzuführen:
1. die Entwicklung der Anzahl der Leistungsfälle,
2. Angaben zur Leistungsdauer,
3. Angaben zum Leistungsort einschließlich Angaben zur Berücksichtigung von Wünschen der Versicherten,
4. Angaben zu Widerspruchsverfahren in Bezug auf die Leistungsbewilligung und deren Ergebnis sowie
5. Angaben zu Satzungsleistungen der Krankenkassen nach Abs. 3 Satz 3.
Die Vorschrift gewährt bei entsprechender Erforderlichkeit Leistungen der Intensivpflege für Personen mit besonders hohem medizinischen Behandlungspflegebedarf. Diese Leistungen können im Rahmen der heutigen medizintechnischen Möglichkeiten innerhalb von Krankenhäusern, aber auch außerklinisch gewährt werden (neu: § 37c SGB V).
Außerklinische Orte für die Erbringung der Intensivpflege stellen dar:
Hintergrund der Einführung des § 37c SGB V ist, dass pflegebedürftige Menschen heute vermehrt bereits zu einem frühen Zeitpunkt aus dem Krankenhaus entlassen werden, um in den eigenen vier Wänden oder in Pflegeeinrichtungen gepflegt werden zu können. Zudem können auf diese Weise Patienten/innen mit Tracheostoma zur Beatmungsentwöhnung und Dekanülierung auch außerhalb von Krankenhäusern behandelt werden.
Personen mit einem hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege haben Anspruch auf Intensivpflege. Diese Voraussetzung liegt vor, wenn die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich ist.
Personen mit bestehender Notwendigkeit einer intensivpflegerischen Versorgung können folgende Kriterien erfüllen:
Aus der Gesetzesbegründung geht hervor, dass „der anspruchsberechtigte Personenkreis nach § 37c SGB V im Wesentlichen der Personenkreis, der nach bisherigem Recht aufgrund eines besonders hohen Bedarfs an medizinischer Behandlungspflege auch bei Unterbringung in stationären Pflegeeinrichtungen ausnahmsweise Anspruch auf häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 2 Satz 3 SGB V hatte, ist“.
Über das Vorliegen der Voraussetzung des vorhandenen hohen Bedarfs an medizinischer Behandlungspflege entscheidet nach Begutachtung durch den Medizinischen Dienst die jeweilige Krankenkasse.
Für die Gewährung von Leistungen der außerklinischen Intensivpflege bedarf es einer ärztlichen Verordnung durch einen Vertragsarzt/einer Vertragsärztin. Weiterhin müssen die Einrichtungsträger Vereinbarungen über die Vergütung und Abrechnung mit den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen entsprechend § 132l SGB V geschlossen haben.
Im Land Bremen existieren mit Stand 07/2023 folgende Intensivpflege-Wohngemeinschaften:
Leistungen der Hilfe zur Pflege sind nachrangig gegenüber Leistungen nach dem SGB XI oder SGB V zu erbringen.
Nach § 37c SGB V werden bei der Inanspruchnahme intensivpflegerischer Leistungen im häuslichen Bereich Leistungen der medizinischen Behandlungspflege erbracht (z. B. Wundversorgung, Verbandwechsel, Medikamentengabe, Dekubitusbehandlung, Blutdruck- und Blutzuckermessung, Überwachung der Beatmung oder das Absaugen bei Patienten/innen mit Tracheostoma). Da § 37c nur die bisherigen Regelungen in § 37 in eine neue Vorschrift überführt hat, kann auf die dortigen Begrifflichkeiten zurückgegriffen werden.
Nach § 17 Abs. 1b SGB XI erlässt der Spitzenverband Bund der Pflegekassen Richtlinien zur Feststellung des Zeitanteils, für den die Pflegeversicherung bei ambulant versorgten Pflegebedürftigen Personen, die einen besonders hohen Bedarf an behandlungspflegerischen Leistungen haben und die Leistungen der häuslichen Pflegehilfe nach § 36 SGB XI und der häuslichen Krankenpflege nach § 37 Abs. 2 SGB V oder die Leistungen der häuslichen Pflegehilfe nach § 36 SGB XI und der außerklinischen Intensivpflege nach § 37c SGB V beziehen, die hälftigen Kosten zu tragen hat. Von den Leistungen der häuslichen Pflegehilfe nach § 36 SGB XI sind dabei nur Maßnahmen der körperbezogenen Pflege zu berücksichtigen.
Intensivpflege Kostenabgrenzung
Diese Richtlinien haben bereits seit 2017 Bestand. Der GKV-Spitzenverband hat für die Feststellung des Zeitanteils, für den die Pflegeversicherung bei intensivpflegerischer Versorgung die Kosten zu tragen hat, folgende pauschale Minutenwerte pro Tag festgelegt:
Pflegegrad 2 | 37 |
Pflegegrad 3 | 76 |
Pflegegrad 4 | 104 |
Pflegegrad 5 | 141 |
Die oben genannten pauschalen täglichen Minutenwerte sind bei gleichzeitiger Erbringung von medizinischer Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 SGB V (bzw. neu nach § 37c SGB V) und körperbezogenen Pflegemaßnahmen im Sinne von § 36 SGB XI durch dieselbe Pflegekraft vom Zeitaufwand, den die gesetzliche Krankenversicherung zu tragen hat, in Abzug zu bringen.
Die Leistungsanbieter rechnen mit der Krankenkasse die Leistungen nach dem SGB V ab. Im Leistungsnachweis werden Leistungen für 24 Stunden nachgewiesen. Die Krankenkasse bewilligt die Leistungen nach § 37 SGB V, bzw. neu nach § 37c SGB V abzüglich der Zeitwerte, die der Pflege zugeordnet werden (siehe obige Tabelle).
Für die Pflegekasse erfolgt die Abrechnung grds. nach Leistungskomplexen. Die Pflegekasse gewährt die entsprechenden pflegerischen Leistungen je nach Pflegegrad nach entsprechenden Pauschalen im Sinne von § 36 SGB XI. Weitere nicht übernahmefähige Kosten der Pflege können sodann dem Sozialhilfeträger in Rechnung gestellt werden.
Für die Berechnung und Gewährung notwendiger Leistungen der Hilfe zur Pflege bei ambulanter Intensivpflege ist folgende Bewilligungspraxis zu berücksichtigen:
Weitere anfallende Kosten wie die Ausbildungsumlage, Investitionskosten und Hilfen bei der Haushaltsführung können im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII entsprechend der sozialhilferechtlichen Voraussetzungen gewährt werden. Die Kürzung des Pflegegeldes im Sinne von § 63b SGB XII ist im Einzelfall zu prüfen.
Sofern die 24h-Versorgung lediglich über Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII sichergestellt worden ist und ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB V besteht, kann Erstattungsanspruch gegenüber der Krankenkasse geltend gemacht werden (§§ 102 ff SGB X).
Erstattungsansprüche verjähren gem. § 113 SGB X in 4 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der erstattungsberechtigte Leistungsträger von der Entscheidung des erstattungspflichtigen Leistungsträgers über dessen Leistungspflicht Kenntnis erlangt hat. Gem. § 111 SGB X ist der Anspruch auf Erstattung ausgeschlossen, wenn der erstattungsberechtigte Leistungsträger ihn nicht spätestens 12 Monate nach Ablauf des letzten Tages, für den die Leistung erbracht wurde, geltend macht. Der Lauf dieser Frist beginnt frühestens mit dem Zeitpunkt, zu dem der erstattungsberechtigte Leistungsträger von der Entscheidung des erstattungspflichtigen Leistungsträgers über seine Leistungspflicht Kenntnis erlangt hat.
In den Fällen, in denen keine Entscheidung über die Leistungspflicht durch den erstattungspflichtigen Leistungsträger ergeht, greift der 4-Jahres-Zeitraum sinngemäß. Damit gilt in diesen Fällen, dass der Anspruch auf Erstattung in 4 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres verjährt, in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist.
Für Personen mit intensivpflegerischen Bedarf ohne bestehende Krankenversicherung sind die Kosten nach Prüfung der beschriebenen Voraussetzungen entsprechend des 5. Kapitels SGB XII zu gewähren. Auf die dazugehörigen Ausführungen wird verwiesen.
Service-Häuser/-Wohnungen sind öffentlich geförderte Häuser/Wohnungen mit einer entsprechenden Zweckbindung für Menschen mit einem Berechtigungsschein. Die Häuser/Wohnungen sind in der Regel barrierearm und für Menschen ab dem 60. Lebensjahr vorgesehen, die einen Wohnberechtigungsschein zum Bezug einer geförderten Mietwohnung haben und zur Unterstützung und Erhalt der Selbständigkeit mindestens den Grundservice benötigen. Die Zentrale Fachstelle Wohnen hat hier Belegungsrechte.
Die von hier anerkannten Service-Häuser/-Wohnungen werden in einer Excel-Tabelle aufgeführt (in OPOS einsehbar). Für die Häuser/Wohnungen wird eine Service-Pauschale anerkannt und aus Mitteln des SGB XII finanziert.
Angebot
Die bezeichneten Altenwohnungen mit Service-Angeboten enthalten ein Betreuungsangebot für ältere Menschen, welches grundsätzlich aus einem Grundservice und einem Wahlservice besteht. Der Grundservice besteht aus folgenden Elementen:
Voraussetzungen der Wohnungen
Die unter diese Regelung fallende Wohnungen gehören im Sinne des Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG) zu den angezeigten öffentlich geförderten Altenwohnungen mit Serviceangeboten, die aus einem Grundservice und abrufbaren Wahlserviceleistungen bestehen. Es handelt sich dabei
An dieser Stelle ist anzumerken, dass das Angebot des Service-Wohnens im Sinne von § 7 des Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetz der Anzeigepflicht nach § 19 dieses Gesetzes unterliegt. Zuständige Behörde für die Anzeige ist die Wohn- und Betreuungsaufsicht. Für ein neues Angebot müssen vom Leistungsanbieter eine Leistungsbeschreibung über den inhaltlichen und zeitlichen Umfang der Leistung und eine Kostenkalkulation vorgelegt werden.
Personenkreis
Eine Kostenübernahme für das Angebot des Service-Wohnens kommt für pflegebedürftige Personen ab PG 1 im Rahmen der Hilfe zur Pflege und für nicht pflegebedürftige alte Menschen im Rahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII in Betracht. Der Zugang zum Service-Wohnen ist grundsätzlich ab dem 60. Lebensjahr geöffnet. Die berechtigten Personen müssen einen Bedarf an den Grundservice zur Unterstützung und zum Erhalt der Selbständigkeit haben. Vorzuweisen ist ein Wohnberechtigungsschein.
In besonders gelagerten Einzelfällen können auch Kosten für Menschen unterhalb der Altersgrenze übernommen werden.
Verfahren
Die Vermittlung von öffentlich geförderten Altenwohnungen und von öffentlich geförderten Altenwohnungen mit Service erfolgt durch die ZFW. Eine Vermittlung von Altenwohnungen mit Service durch die ZFW erfolgt nur, wenn ein Grundservice notwendig ist. Die Notwendigkeit der Versorgung mit dem Grundservice wird durch die ZFW nach den hier genannten Kriterien verbindlich festgestellt. Sollte die Notwendigkeit durch die ZFW nicht eindeutig festgestellt werden können, ist der Sozialdienst Erwachsene des zuständigen Sozialzentrums bzw. Fachdienst Teilhabe zu beteiligen. Die Wirtschaftlichen Hilfen des Fachdienstes Soziales sind für die sozialhilferechtliche Prüfung und Bearbeitung, sowie für die Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides zuständig.
Vergütung
Der Grundservice wird mit einer monatlichen Pauschale gewährt und beträgt maximal:
Von den verschiedenen Anbietern werden unterschiedliche Leistungen mit unterschiedlichen Kosten angeboten. Die benannten Beträge sind daher Maximalkosten, die im Rahmen des Grundservice anerkannt werden können.
Für die von hier anerkannten Service-Häuser/-Wohnungen werden die anzuerkennenden Kosten in der Excel-Liste (in OPOS) mit aufgeführt. Die Liste befindet sich hier:
Der Wahlservice wird in den einzelnen Häusern individuell angeboten und ist nicht Gegenstand der Pauschale.
Sofern Leistungen für den Hausnotruf einzelfallbezogen durch die Pflegekasse, bzw. bei nichtversicherten pflegebedürftigen Personen durch den Sozialhilfeträger bewilligt werden, sind diese von der Grundpauschale in Abzug zu bringen.
Umgang mit Angeboten von Service-Wohnen außerhalb der in der Tabelle aufgeführten anerkannten Angeboten
Im Einzelfall können Kosten für das Service-Wohnen bis zur anzuerkennenden Höhe bei festgestellter Notwendigkeit sowie inhaltsgleicher Ausrichtung des Service-Wohnens auch für Wohnungen außerhalb der in der Excel-Tabelle (Liste Service-Wohnen) aufgeführten Adressen zu den in dieser Verwaltungsanweisung beschriebenen angemessenen Kosten übernommen werden. Voraussetzung ist jedoch auch, dass das Service-Wohnen im Rahmen des Wohn- und Betreuungsgesetzes angezeigt wird.
Für vormals öffentlich geförderte Altenwohnungen mit Service, die die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen (z. B. nicht mehr öffentlich geförderter Wohnraum, Belegungsbindung der ZFW ist entfallen), aber weiterhin einen Service anbieten, sind weiterhin die Leistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner in bisheriger Höhe zu erbringen. Für Neueinzüge ist diese Übergangsregelung dann nicht mehr anzuwenden.
Die Tagesbetreuung für demenzkranke ältere Menschen stellt ein niedrigschwelliges teilstationäres Angebot dar, welches zum zu einem nach Landesrecht anerkannten Angebot zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a SGB XI gehört. Pflegebedürftige Menschen ab PG 1 haben daher die Möglichkeit, dieses Angebot mit Hilfe des ihnen zustehenden Entlastungsbetrages wahrzunehmen (§§ 45b SGB XI, 64i SGB XII, 66 SGB XII)
Sollte der Entlastungsbetrag zur Finanzierung dieser Maßnahme nicht ausreichend sein, können bei bestehender Notwendigkeit zusätzlich Leistungen der Tagespflege als teilstationäres Angebot nach § 64g SGB XII bewilligt werden.
Die Tagesbetreuung erfolgt i. d. R. zweimal wöchentlich. Sie umfasst Frühstück, Mittagessen und ggf. den Hol- und Bringedienst.
Diese Betreuungsart enthält u. a. Maßnahmen des Realitäts-Orientierungs-Trainings, des Gedächtnistrainings und des Einübens motorischer Fertigkeiten und steht alten Menschen zur Verfügung, deren zeitweilige Betreuung und Versorgung in dem eigenen Haushalt durch Angehörige, Nachbarn oder sonstige ambulante Hilfen allein nicht sichergestellt werden kann. Es werden keine pflegerischen Tätigkeiten ausgeübt, wobei Hilfen beim Essen und Toilettengang nicht ausgeschlossen sind. Ziel dieser Maßnahme ist, ein möglichst weitgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Da sie auch betreuende Angehörige entlastet, werden stationäre Maßnahmen, wie z. B. stationäre gerontopsychiatrische Versorgung, vermieden.
Die Leistungen der Hilfe zur Pflege, Hilfen bei der Haushaltsführung, Leistungen der Altenhilfe und Leistungen nach dem 9. Kapitel des SGB XII werden aus der Fallakte und mit Hilfe des IT-Fachverfahren OpenProsoz direkt zahlbar gemacht.
Die Rechnungen und Stundennachweise der Leistungsanbieter werden den Sozialzentren bzw. den Fachdiensten zugeleitet. Seitens der Wirtschaftlichen Hilfen werden diese auf sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft und dann über OpenProsoz dem Leistungsberechtigter Person oder Leistungsanbieter ausgezahlt.
Prüfung:
Die Rechnungen sind sachlich und rechnerisch zu prüfen.
Aus Datenschutzgründen ist die Übersendung von Pflegedokumentationen an den Sozialhilfeträger ausgeschlossen. Nur die fachärztlichen Dienste wie der MD und das GAB haben Einblick in die Pflegedokumentationen und können somit fundierte, im Einzelfall notwendig werdende/gewordene Anpassungen der Pflegedienstleistungen beurteilen.
Die sachliche Prüfung durch den Sozialhilfeträger beinhaltet einen Vergleich des Leistungsnachweises mit den in der Kostenzusicherung zugesagten Leistungen. Weichen die im Leistungsnachweis dokumentierten Leistungen von der Kostenzusicherung ab, sind sie ohne Begründung des Leistungsanbieters nur zu akzeptieren, wenn sie kurzzeitig über wenige Tage im Monat abweichen. Diesbezüglich sollte eine Rücksprache mit dem Leistungsanbieter erfolgen, um im Falle einer Bedarfserhöhung oder –veränderung ein neues Hilfeplanverfahren einleiten zu können. Maßgebend ist der jeweilige Abrechnungsmonat.
Entsprechend des gültigen Rahmenvertrages über die ambulante pflegerische Versorgung gem. § 75 Abs. 1 SGB XI beinhaltet der Leistungsnachweis:
Die durchgeführten Leistungen sind täglich einzutragen und von der Pflegekraft nach dem Einsatz abzuzeichnen und durch die pflegebedürftige Person bzw. Angehörigen zu bestätigen. Einer Unterschrift durch die Einrichtung bedarf es nicht.
Die pflegefachliche Prüfung ist Aufgabe des Gesundheitsamtes nach dem Hilfeplanverfahren bzw. außerhalb des Hilfeplanverfahrens anlassbezogen.
Die rechnerische Prüfung beinhaltet einen Vergleich des Rechnungsbetrages mit der durchschnittlichen monatlichen Leistungshöhe. Überschreitet der Rechnungsbetrag die Leistungshöhe, weil sich aus der Anzahl der Tage, Feiertage des jeweiligen Monats sich unterschiedliche Häufigkeiten der Pflegeeinsätze ergeben, ist der gesamte Rechnungsbetrag zu überweisen.
Die rechnerische und sachliche Prüfung:
beinhaltet nur die Überprüfung der geleisteten Zeiten im Stundennachweis oder in der Rechnung mit den bewilligten Leistungen (in Zeit) sowie die Prüfung des Entgeltes. Dabei sind die Grundsätze der rechnerischen Prüfung anzuwenden.
Interventionen:
Bei einer kurzzeitigen Abrechnung anderer als in der Kostenzusicherung aufgeführten Bedarfe sollte ggf. Rücksprache mit dem jeweiligen Leistungsanbieter gehalten werden. Sollte ein Leistungsanbieter im Abrechnungsmonat nicht nur kurzzeitig andere Leistungen als in der Kostenzusicherung beschrieben erbringen, ist die Überprüfung des Bedarfes zu veranlassen. Leistungen sind nur zu erbringen, wenn sie als notwendig und angemessen anerkannt sind.
Sollten indirekte Leistungen (z. B. Wegepauschale) zwar in der Rechnung, aber nicht auf dem Leistungsnachweis aufgeführt werden, sind diese auf Korrektheit und Nachvollziehbarkeit zu prüfen und bei nachvollziehbarem Bedarf zu bewilligen.
Bei Einsatz eines Leistungsanbieters außerhalb Bremens (z. B. aus Niedersachsen) ist der dortige Leistungskomplexkatalog zu beachten. Der festgestellte Bedarf ist möglichst auf den anzuwendenden Leistungskomplexkatalog zu übertragen.
Bei Verdacht auf ein vertragswidriges Verhalten, der nicht nachvollziehbar oder bedarfsmäßig erklärbar ist, ist die Projektgruppe „Vermeidung und Aufklärung von vertragswidrigem Verhalten ambulanter Pflegedienste in der Hilfe zur Pflege – Prüfgruppe Hilfe zur Pflege“ zu kontaktieren (siehe nächster Punkt).
Rechnungen der Pflegedienste:
Die Rechnungslegung der Pflegedienste erfolgt monatlich durch Vorlage der Rechnung und des Leistungsnachweises, bei Pflegeversicherten nach erfolgter Abrechnung mit der Pflegekasse. Die Rechnungen sind nach erfolgter Prüfung zahlbar zu machen. Die Investitionskosten sind nicht gesondert zu buchen, sondern der Ausgangsleistung zuzuordnen.
Beispiel:
Kostenzusicherung:
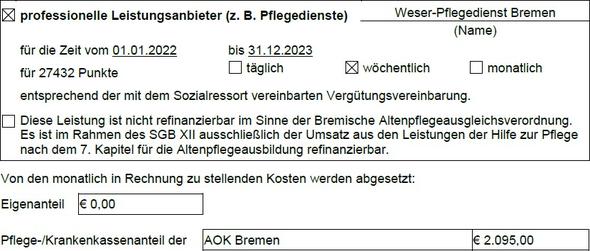
Die Anlage zur Kostenzusicherung enthält die festgestellten Leistungskomplexe aus dem Hilfeplan.
Aus der zum Bewilligungszeitraum gültigen Vergütungsvereinbarung geht der maßgebliche Punktwert hervor, in diesem Fall € 0,05556 pro Punkt.
Rechnung:
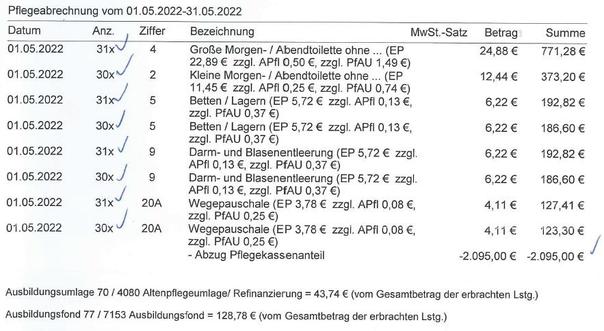
Leistungsnachweis:
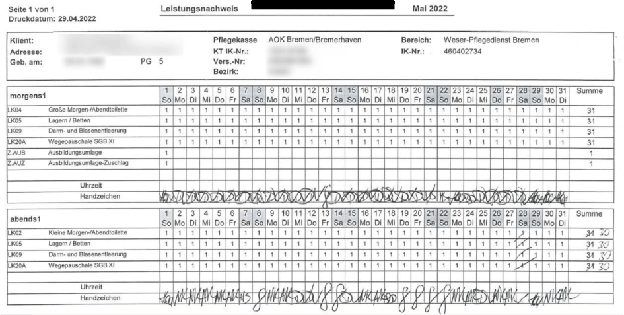
Die Investitionskosten werden in diesem Fall gesondert abgerechnet.
Stundennachweise von Haushaltshilfen/Nachbarschaftshilfen/Pflegepersonen
Die Stundennachweise werden monatlich vorgelegt. Die Zahlung erfolgt nach abgeschlossener Prüfung. Hinsichtlich der angemessenen Leistungshöhe wird auf die Verwaltungsanweisung über „Leistungen für hauswirtschaftliche Verrichtungen – Haushaltshilfe“ verwiesen.
Die Verwaltungspauschale der Dienstleistungszentren ist in vereinbarter Höhe für den Bewilligungszeitraum laufend monatlich (per Ultimo) an die DLZ zu zahlen. Unterbrechungen beim Einsatz der Nachbarschaftshilfe oder Alltagsassistenz von bis zu einem Monat wirken sich nicht auf die Zahlung der Verwaltungspauschale aus. Erfolgt kein Einsatz einer Nachbarschaftshilfe oder Alltagsassistenz von mehr als einem Monat, gilt der Einsatz als beendet, die Verwaltungspauschale ist dann nicht zu leisten. Die DLZ teilen den Sozialzentren bzw. Fachdiensten die Beendigung mit.
ISB:
Die Rechnungslegung der ISB-Träger erfolgt durch Vorlage der Rechnungen getrennt nach Pflege/Haushalt und Teilhabe und dem Stundennachweis (Gesamtleistung Grundpflege/Haushalt/Teilhabe) nach Abrechnung mit der Pflegekasse. Die Rechnungen sind nach erfolgter Prüfung getrennt nach Grundpflege/Haushalt und Teilhabe zahlbar zu machen. Die Investitionskosten sind nicht gesondert zu buchen, sondern der Ausgangsleistung zuzuordnen.
Es wird auf die Fachliche Mitteilung zur „rechtlichen Bedarfszuordnung im Leistungssetting Ambulante Maßnahme Persönliche Assistenz (ISB) vom 06.12.2022 verwiesen.
Akzent-Wohnen:
Die Rechnungslegung des Akzents-Wohnen erfolgt getrennt nach Pflege/Haushalt und Teilhabe nach Leistungskomplexen. Die Rechnungen des Akzents-Wohnen sind wie die Rechnungen eines Pflegedienstes zu prüfen. Die Leistungen für den Bereitschaftsdienst sind der Pflege zuzuordnen.
Die Leistungen für pädagogische Hilfeleistungen in der Wohngemeinschaft des Akzent-Wohnens der Seilerstraße sind monatlich nach Vorlage der Rechnung und erfolgter Prüfung in der vereinbarten Höhe zu zahlen und den Teilhabeleistungen zuzuordnen.
Die Investitionskosten sind nicht gesondert zu buchen, sondern der Ausgangsleistung zuzuordnen.
Tagespflege
Die Rechnungslegung der Einrichtungen der Tagespflege erfolgt durch Vorlage der Rechnung, bei pflegeversicherten Personen nach erfolgter Abrechnung mit der Pflegekasse. Die Rechnungen sind nach erfolgter Prüfung zahlbar zu machen. Der Förderbetrag ist nicht gesondert zu buchen, sondern der Ausgangsleistung zuzuordnen.
Kurzzeitpflege
Die Rechnungslegung der Einrichtungen der Kurzzeitpflege erfolgt durch Vorlage der Rechnung, bei pflegeversicherten Personen nach erfolgter Abrechnung mit der Pflegekasse. Die Rechnungen sind nach erfolgter Prüfung zahlbar zu machen. Der Förderbetrag ist nicht gesondert zu buchen, sondern der Ausgangsleistung zuzuordnen.
Die Ablage der eingereichten Rechnungen und Stundennachweise erfolgt in einer Nebenakte. Für jede Fallart (Haushaltshilfen/Pflegepersonen, Pflegedienst, ISB, Akzent-Wohnen, Tagespflege – bis auf Kurzzeitpflege) ist eine Nebenakte anzulegen. Als Vorblatt ist in der Nebenakte das Formular „Übersichtsbogen“ und ggf. ergänzend andere vergleichbare der Übersicht dienende interne Unterlagen zu führen und zu aktualisieren. Es dient der Übersicht über die bewilligten und abzurechnenden Leistungen.
Zum 01.01.2020 haben die Sozialhilfeträger eigene Prüfrechte und Prüfpflichten im Rahmen der §§ 76a und 78 SGB XII mit der Möglichkeit bzw. Verpflichtung der Prüfung erhalten, ob ambulante Leistungserbringer der Pflege ihre gesetzlichen und vertraglichen Pflichten erfüllen.
Für das Prüfverfahren nach § 76a Abs. 2 SGB XII bedarf es Anhaltspunkte bezüglich einer Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Vorgaben. Die Vorschrift zielt auf Pflegemängel, Personalversorgung, Dokumentationsmängel ab. Anhaltspunkte können durch Rechnungsprüfungen, Hinweisen leistungsberechtigter Personen, Angehörigen, Ärzte/Ärztinnen usw. erfolgen. Allgemein gehaltene Hinweise oder Vermutungen reichen nicht aus. Vertragliche Pflichten können sich aus den mit dem Sozialhilfeträger geschlossenen Vereinbarungen ergeben. Gesetzliche Pflichten ergeben sich beispielsweise aus § 75 Abs. 2 S. 3 ff SGB XII.
Durch die Bezugnahme auf § 78 SGB XII besteht eine Pflicht zur Einleitung des Verfahrens. Eine Ausnahme erfolgt, wenn eine Prüfung nach § 79 SGB XI durchgeführt wird oder ein Auftrag für eine Anlassprüfung durch die Landesverbände der Pflegekassen nach § 114 SGB XI erfolgt. Erfolgt keine Prüfung durch diese, hat der Sozialhilfeträger eine Prüfung nach § 78 SGB XII durchzuführen.
Nach § 78 Abs. 1 S. 1 SGB XII prüft der Sozialhilfeträger die Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen des Leistungserbringers, soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt. Nach § 78 Abs. 1 S. 2 SGB XII sind die Leistungserbringer verpflichtet, dem Sozialhilfeträger auf Verlangen für die Prüfung erforderliche Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen.
Der Sozialhilfeträger kann einen Dritten mit der Durchführung der Prüfung beauftragen.
Bei den sogenannten vereinbarten Leistungen geht es um Leistungen und Verpflichtungen, die sich für den Leistungserbringer aus der Leistungsvereinbarung nach § 76 Abs. 2 SGB XII ergeben. Es müssen Anhaltspunkte vorliegen, dass der Leistungserbringer Leistungen entgegen der Vereinbarung nicht, nur teilweise oder nicht in der vereinbarten Qualität erbringt. Eine Abrechnung von nicht erbrachten Leistungen gegenüber den Sozialhilfeträger stellt beispielsweise eine erhebliche Verletzung der Pflichten aus der Vergütungsvereinbarung dar.
Soweit gegen eine Haupt- oder Nebenpflicht aus den Verträgen oder gesetzlichen Regelungen verstoßen wird, besteht eine Prüfpflicht des Sozialhilfeträgers.
Nach § 78 Abs. 2 SGB XII erfolgt die Prüfung ohne vorherige Ankündigung und erstreckt sich auf Inhalt, Umfang, Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der erbrachten Leistungen.
Nach § 78 Abs. 3 SGB XII hat der Sozialhilfeträger den Leistungserbringer über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu unterrichten. Soweit ein Prüfbericht erstellt wurde, genügt dessen Übersendung. Der leistungsberechtigten Person ist das Ergebnis der Prüfung in einer wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen. Gegenüber der leistungsberechtigten Person besteht damit ein größerer Spielraum, um das Prüfungsergebnis mitzuteilen (mündlich, schriftlich). Beeinträchtigungen der leistungsberechtigten Person sind zu berücksichtigten.
Die Verpflichtung der Ergebnismitteilung obliegt dem Sozialhilfeträger und kann nicht delegiert werden.
Projekt: Prüfgruppe – Hilfe zur Pflege
Für die Kommune Bremens wurde nach Beschluss der städtischen Deputation für Soziales, Jugend und Integration am 24.09.2020 das erstellte Konzept zur „Vermeidung und Aufklärung von vertragswidrigem Verhalten durch ambulante Pflegedienste in der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in der Stadtgemeinde Bremen“ zur Kenntnis genommen sowie dem Einsetzen eines Projekts mit entsprechendem Stellenanteil zugestimmt. Mit der Einführung dieses Projekts bzw. der Prüfgruppe – Hilfe zur Pflege beim Gesundheitsamt Bremen wird den Prüfrechten und Prüfpflichten aus §§ 76a, 78 SGB XII Rechnung getragen. Ziel ist die Prüfung der Leistungserbringung häuslicher Pflegehilfen im Einzelfall in Form der Rechnungsprüfung und der vertragsgemäßen Leistungserbringung.
Im Rahmen der Einführung des Projektes „zur Vermeidung und Aufklärung von vertragswidrigem Verhalten durch ambulante Pflegedienste“ erfolgt die Umsetzung der etablierten Prüfrechte und –verpflichtungen insbesondere bezogen auf den Einzelfall durch die seit 09/2021 installierte Prüfgruppe – Hilfe zur Pflege.
Mit der geschlossenen Projektvereinbarung werden u. a. die Kooperationsbeziehungen zwischen der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration, der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, dem Amt für Soziale Dienste Bremen und dem Gesundheitsamt Bremen festgelegt.
Präsenztermine
Die Prüfgruppe – Hilfe zur Pflege hält regelmäßige Präsenz- oder Videokonferenztermine in/mit den einzelnen Sozialzentren bzw. Fachdiensten ab. Innerhalb dieser Zeiten können Meldungen zum vertragswidrigem Verhalten sowie Fälle, Auffälligkeiten, Verfahren, u. ä. besprochen werden. Seitens der Prüfgruppe werden Hilfestellungen und Beratungen angeboten. Über aktuelle Fälle wird informiert und Rücksprache gehalten.
Außerhalb der Präsenztermine können Prüfaufträge bzw. Anhaltspunkte von vertragswidrigem Verhalten über das Funktionspostfach vwv@gesundheitsamt.bremen.de gemeldet werden.
Meldungen an die Prüfgruppe
Nach § 78 Abs. 1 S. 1 SGB XII prüft der Sozialhilfeträger die Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen des Leistungserbringers, soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt.
Soweit gegen eine Haupt- oder Nebenpflicht aus den Verträgen oder gesetzlichen Regelungen verstoßen wird, besteht eine Prüfpflicht des Sozialhilfeträgers.
Das Amt für Soziale Dienste meldet der Prüfgruppe von sich aus Auffälligkeiten von vertragswidrigem Verhalten. Verdachtsfälle können z. B. sein:
Die Prüfgruppe – Hilfe zur Pflege kann zusätzliche eigenständige und fachlich abgesicherte Prüfungen auf Basis der mit den Kooperationspartnern vereinbarten Kriterien durchführen (z. B. Prüfungen zu bestimmten LK).
Ablauf der Prüfungen
Die Prüfgruppe ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen.
Vor der Durchführung einer Prüfung bei pflegeversicherten leistungsberechtigten Personen wird mit der Prüfgruppe der Kranken- und Pflegekassen (GKV-Prüfgruppe) Rücksprache darüber gehalten, ob von dort bereits eine Prüfung erfolgt. Doppelprüfungen sind zu vermeiden. Bei tiefgehenden Prüfungen sollte möglichst die Pflegekasse der leistungsberechtigten Person mit einbezogen werden.
Notwendige Unterlagen für eine Prüfung werden herangezogen und eingesehen, z. B.:
Zusätzlich können z. B. Hausbesuche bei der leistungsberechtigten Person, Prüfungen bei den Pflegediensten vor Ort und auch Interviews (z. B. mit der leistungsberechtigten Person, Angehörigen, dem Pflegedienst, o. ä.) durchgeführt werden. Die Prüfgruppe agiert im regelmäßigen Austausch mit dem Amt für Soziale Dienste. Im Bedarfsfall können seitens der Prüfgruppe auch Kommunikationen/Ab- und Rücksprachen zwischen dem Referat 24 des Gesundheitsamtes und/oder der Kriminalpolizei erfolgen.
Bei einem festgestellten möglichen Schaden wird dem betroffenen Pflegedienst seitens der Prüfgruppe die Möglichkeit einer Stellungnahme gegeben. Nach Ablauf einer gesetzten angemessenen Frist je nach Fallsituation wird bei einer Nichtabgabe dieser eine Erinnerung mit einer kürzeren Frist ausgesprochen. Feier- und Wochenendtage sind zu berücksichtigen. Die Inhalte der Stellungnahme fließen in das seitens der Prüfgruppe zu erstellende Prüfergebnis ein.
Das Prüfergebnis weist insbesondere die inhaltliche Prüfung als solches, die konkrete Beschreibung der festgestellten Auffälligkeiten, die Inhalte der Stellungnahme, Bezifferung des bereits entstandenen Schadens und Bezifferung des prospektiven Schadens (auf Grundlage der erstellten Kostenzusicherung/des erstellten Bewilligungsbescheides) aus. Weiterhin werden Empfehlungen zu weiteren möglichen und notwendigen Verfahrensschritten ausgesprochen (z. B. Geltendmachung von Rückforderungen, Erstellen von Strafanzeigen, Durchführung von Hausbesuchen, Einleitung eines neuen Hilfeplanverfahrens, o. ä.).
Das Prüfergebnis wird auf dem Dienstweg über Referats- und Teamleitung dem/r jeweiligen Sachbearbeiter/in des Amtes für Soziale Dienste zugeleitet. Eine Durchschrift des Prüfungsergebnisses geht an die Fachkoordination des Amtes für Soziale Dienste. Das weitere Bearbeitungsverfahren legt das Amt für Soziale Dienste fest.
Seitens der Prüfgruppe – Hilfe zur Pflege werden sowohl der festgestellte eingetretene als auch der prospektive Schaden manuell statistisch erfasst. Die Schadenshöhen werden im Laufe des weiteren Verfahrens ggf. aktualisiert und angepasst.
Einzuleitende Verfahrensschritte
Das Amt für Soziale Dienste trifft Entscheidungen zum weiteren verwaltungsrechtlichen Vorgehen auf Grundlage des Prüfergebnisses, der dort benannten eingetretenen möglichen Schäden und der benannten Empfehlungen.
Rückforderungen gegenüber dem Pflegedienst sind geltend zu machen.
Rückforderungen gegenüber der pflegebedürftigen Person sind entsprechend der Vorschriften zu §§ 45 ff. SGB X geltend zu machen.
Rechtsstreitige Verfahren mit einer Schadenssumme oberhalb von 1.000,00 € können an das Rechtsreferat abgegeben werden.
Für die Verbuchung von Rückforderungen ist über den Vordruck V19 „Laufzettel Einnahmen zur Anforderung eines Kassenzeichens“ und unter Benennung der Innenauftragsnummer B1610020 ein Kassenzeichen anzulegen. Mit Einrichtung der Innenauftragsnummer ist eine Auswertung der Rückforderungen möglich. Als Forderungsgrund ist das jeweilige Bezugsaktenzeichen des Amtes für Soziale Dienste zu benennen.
Die Entscheidung zu stellender Strafanzeigen obliegt dem Amt für Soziale Dienste. Die Entscheidung über das Stellen einer Strafanzeige ist nach entsprechender Verhältnismäßigkeit zu treffen. Gründe für oder gegen das Stellen von Strafanzeigen können sein:
Die Prüfgruppe – Hilfe zur Pflege behält die Übersicht über die laufenden Einzelfälle. In bestimmten Fallkonstellationen, z. B. bei eingetretenen Schäden in mehreren Fällen durch einen Pflegedienst, obliegt der Prüfgruppe die Möglichkeit, Kontakt zur Fachkoordination des Amtes für Soziale Dienste und/oder der Kriminalpolizei aufzunehmen, um das weitere Verfahren zu besprechen.
Abschluss
Der Fachkoordination des Amtes für Soziale Dienste sind nach Abschluss der Fallbearbeitung Durchschriften erstellter Rückforderungsbescheide, Strafanzeigen, Geldeingangsmitteilungen, Umsetzungen der Empfehlungen, o. ä. zuzuleiten. Die Prüfgruppe erstellt einmal im Quartal einen Bericht, der sowohl an die Abteilung Soziales der Sozialbehörde (400-32-6) als auch an die Fachkoordination des Amtes für Soziale Dienste übersandt wird.
Der Leistungserbringer ist schriftlich über das Ergebnis zu unterrichten (Prüfbericht gem. § 78 Abs. 3 SGB XII). Der leistungsberechtigten Person ist das Prüfergebnis in einer wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen – eine mündliche Information kann grundsätzlich als ausreichend angesehen werden. Die Verpflichtung der Ergebnismitteilung durch Erstellen eines Prüfberichts obliegt dem Amt für Soziale Dienste, da diese Aufgabe nicht delegiert werden kann.
Im Folgenden werden mögliche Konkurrenzen bzw. Zweckidentitäten anderer Leistungen in Bezug auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege dargestellt.
Menschen mit Behinderungen und gleichzeitigem Bedarf an pflegerischen Leistungen erhalten oft eine Kombination aus Leistungen der Eingliederungshilfe des SGB IX, der Pflegeversicherung nach dem SGB XI und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.
In der „Rahmenrichtlinie gem. § 5 Abs. 2 BremAG SGB XII – Eingliederungshilfe“ wird das Verhältnis der Eingliederungshilfeleistungen, Leistungen der Pflege und Leistungen der Hilfe zur Pflege beschrieben. In § 13 SGB XI wird in Abs. 3 deutlich, dass Leistungen der Eingliederungshilfe und Leistungen der Pflege nach dem SGB XI gleichrangig nebeneinanderstehen. Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII sind als nachrangig gegenüber Leistungen der Pflege nach dem SGB XI zu betrachten.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass entscheidend für die Zuordnung der einzelnen Leistungen die Zielsetzung ist, die für die in Frage stehenden Leistungen überwiegend bestimmt ist. Hilfe zur Pflege ist grundsätzlich dann zu gewähren, soweit bei Personen, die wegen einer Behinderung der Hilfe bedürfen, die Erhaltung und Sicherung der vorhandenen Lebensmöglichkeiten im Vordergrund steht.
Die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen dem SGB XI und dem SGB V betreffen in erster Linie die Hilfsmittel. In der Sozialhilfepraxis werden diese Fragen bei leistungsberechtigten Person entstehen, die nicht pflegeversichert sind.
Pflegehilfsmittel grenzen sich von Hilfsmitteln im Sinne der Krankenversicherung dadurch ab, dass sie weder der Krankheitsbehandlung noch dem Ausgleich von Behinderung dienen.
Die Zuständigkeit nach dem SGB V ergibt sich somit für Hilfsmittel, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern oder eine Behinderung auszugleichen.
Die Zuständigkeit nach dem SGB XI ergibt sich für Hilfsmittel (Pflegehilfsmittel), wenn diese zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden der pflegebedürftigen Personen Person beitragen oder ihm eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen. Die Gewährung eines Pflegehilfsmittels nach § 40 SGB XI setzt voraus, dass ein Anspruch nach dem SGB V nicht besteht.
Pflegebedürfte Personen ab PG 2 haben bei Vorliegen der Voraussetzungen Zugang zum vollen Leistungsangebot nach dem SGB XI, bzw. der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII. Damit verankert ist u. a. auch die Möglichkeit der Gewährung der Kosten eines Aufenthalts im Rahmen einer Kurzzeitpflege. Personen mit PG 1 oder fehlender Pflegebedürftigkeit haben keinen Zugang auf Gewährung der Kosten für eine Kurzzeitpflege nach dem SGB XI oder dem 7. Kapitel des SGB XII (lediglich auf die Zielsetzung des Entlastungsbetrages bei PG 1 wird verwiesen).
Seit dem 01.01.2016 besteht ein Leistungsanspruch bei der Unterstützung durch Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 37 Abs. 1a SGB V), auf Versorgung durch Haushaltshilfen (§ 38 SGB V) und auf Leistungen für Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürftigkeit und bei PG 1 (§ 39c SGB V) wegen schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere
Voraussetzungen sind, dass keine Pflegebedürftigkeit ab PG 2 nach dem SGB XI gegeben ist (z. B. weil der Unterstützungsbedarf nur von kurzer Dauer ist) und nicht andere, insbesondere im Haushalt lebende Personen die notwendigen Unterstützungsleistungen übernehmen können.
Der Anspruch bei der Haushaltshilfe ist nach § 38 SGB V auf 4 Wochen begrenzt. Der Anspruch verlängert sich auf längstens 26 Wochen, wenn im Haushalt ein Kind lebt, welches bei Beginn der Haushaltshilfe das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder welches behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Als Satzungsleistungen können die Krankenkassen bei der Haushaltshilfe nach § 38 SGB V über den Pflichtleistungsanspruch hinausgehende Ansprüche vorsehen, die z. B. eine längere Leistungsdauer regeln.
Der Leistungsanspruch auf Kurzzeitpflege ist an die Leistungsdauer, Leistungshöhe und an die Leistungsinhalte des § 42 SGB XI angelehnt. Die Kurzzeitpflege kann in zugelassenen Einrichtungen nach dem SGB XI oder in anderen geeigneten Einrichtungen erbracht werden. Ein Anspruch auf eine Leistungserhöhung oder Verlängerung des zeitlichen Leistungsanspruchs nach § 42 Abs. 2 Satz 3 SGB XI wegen Nichtinanspruchnahme von Verhinderungspflege besteht in diesen Fällen nicht.
Entsprechend § 37b SGB V ist eine Palliativversorgung auch im ambulanten Setting möglich. Die Leistung als solches muss von einem Vertrags- oder Krankenhausarzt verordnet werden. In Bremen übernimmt der spezialisierte ambulante Palliativdienst die Übernahme dieser Versorgung (Ambulante Palliativdienste Bremen SAPV - Förderverein Palliativstation am Klinikum Links der Weser e.V. (palliativ-bremen.de)). Sofern die Voraussetzungen nach § 37b SGB V erfüllt sind, werden die Kosten einschließlich ärztlicher und pflegerischer Leistungen aus Mitteln des SGB V übernommen. Einer Aufstockung im Rahmen der Hilfe zur Pflege bedarf es dann nicht.
Hilfen bei der Haushaltsführung sind Bestandteil der Hilfe zur Pflege, wenn eine Leistungsberechtigung nach dem 7. Kapitel des SGB XII besteht.
Können Leistungen der Hilfen bei der Haushaltsführung wegen fehlender Anspruchsberechtigung nicht der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII zugeordnet werden, ist zu prüfen, ob die Leistung der Hilfen bei der Haushaltsführung als existenzsichernde Leistung dem 3. bzw. 4. Kapitel des SGB XII, als Leistung des 9. Kapitels (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes) oder dem SGB II zuzuordnen ist.
Das Landespflegegeld nach dem Bremischen Landespflegegeldgesetz stellt eine gleichartige Leistung im Sinne von § 63b Abs. 1 Satz 3 SGB XII dar, auch wenn das Landespflegegeld wegen Blindheit geleistet wird. Das Landespflegegeld ist auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege anzurechnen.
Auf das Pflegegeld nach § 64a SGB XII sind die Pflegezulagen nach §§ 35 BVG, 269 LAG sowie das Pflegegeld nach § 44 SGB VII als gleichartige Leistung anzurechnen.
Entsprechend § 63b Abs. 2 SGB XII ist die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII auf das Pflegegeld nach § 64a SGB XII mit 70% anzurechnen.
Entsprechend § 72 SGB XII sind auf die Blindenhilfe Leistungen des SGB XI, auch soweit es sich um Sachleistungen handelt, mit 50% des Pflegegeldes des Pflegegrades 2 und bei pflegebedürftigen Personen der Pflegegrade 3, 4 und 5 mit 40% des Pflegegeldes des Pflegegrades 3 anzurechnen (höchstens jedoch 50% der Blindenhilfe).
Leistungen der häuslichen Pflegehilfe, der Verhinderungspflege, Leistungen im Rahmen des Arbeitgebermodells sowie gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden neben einem Pflegegeld nach § 64a SGB XII erbracht.
In diesen Fällen und um eine mögliche doppelte Bedarfsdeckung zu vermeiden, wird in § 63b Abs. 5 SGB XII geregelt, dass das Pflegegeld um bis zu zwei Drittel gekürzt werden kann. Eine Kürzung um zwei Drittel führt zu einer Gewährung eines gekürzten Pflegegeldes je nach Pflegegrad um ein Drittel. Die Verpflichtung und Notwendigkeit, dass die erforderliche Pflege in geeigneter Weise selbst sicherzustellen und das Pflegegeld zweckbestimmt einzusetzen ist, gilt auch hier (§ 64a Abs. 1 S. 2 SGB XII).
Der Gesetzgeber hat dem Sozialhilfeträger in zweifacher Hinsicht einen Ermessensspielraum eingeräumt. Es muss entschieden werden:
Bei dieser Ermessensentscheidung ist entscheidend, in welchem Umfang der mit der Gewährung des Pflegegeldes verbundene Zweck zur eigenen Sicherstellung der Pflege erfüllt wird und inwiefern andere Leistungen nach §§ 64b, 64c oder 64f Abs. 3 SGB XII (häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflege im Rahmen des Arbeitgebermodells) überflüssig gemacht werden. Dabei ist auf die Besonderheiten des Einzelfalles abzustellen. Eine schematische Kürzung darf nicht vorgenommen werden, sie führt zur Rechtswidrigkeit der Entscheidung.
Der Charakter des Pflegegeldes besteht unter anderem darin, die Pflegebereitschaft der Pflegeperson zu wecken oder zu erhalten. Des Weiteren stellt das Pflegegeld eine zweckgerichtete Aufwandspauschale dar, mit Hilfe derer die mittelbar mit der Pflegebedürftigkeit zusammenhängenden Mehrkosten abgedeckt werden sollen. Der Gesetzgeber stellt insbesondere darauf ab, dass mindestens 1/3 des Pflegegeldes dazu bestimmt ist, die Pflegebereitschaft von ehrenamtlichen Pflegepersonen oder Angehörigen zu erhalten. Es ist zu berücksichtigen wie sich das Verhältnis des Pflegeeinsatzes von ehrenamtlichen Pflegepersonen (und Angehörigen) zum Einsatz angestellter und aus öffentlichen Mitteln finanzierter Pflegekräfte darstellt. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass je größer der Anteil der von der Pflegeperson übernommenen Pflege am Gesamtpflegebedarf ist, desto geringer die Kürzung des Pflegegeldes auszufallen hat. Die volle Kürzung um 2/3 ist nur dann zulässig, wenn ausnahmslos alle Aufwendungen durch den Sozialhilfeträger in vollem Umfang auch tatsächlich gleistet werden. Andernfalls ist eine pauschale Kürzung ohne Würdigung des Einzelfalles nicht ermessensfehlerfrei.
Die Entlastungsbeträge nach §§ 45b SGB XI, 64i und 66 SGB XII werden nicht auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege angerechnet.
Eine Ausnahme stellt die Bewilligung von Leistungen oberhalb des Entlastungsbetrages bei pflegebedürftigen Personen des PG 1 dar. In diesen Fällen ist bei einer Gewährung weiterer Kosten für die Bereiche körperbezogener Pflegemaßnahmen, pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und/oder Hilfen bei der Haushaltsführung Voraussetzung, dass der von der Pflegekasse oder dem Sozialhilfeträger bewilligte Entlastungsbetrag in Höhe von 125 € zunächst für diese Maßnahmen eingesetzt wird.
Bei Leistungen, z. B. bei der Kurzzeitpflege und Tagespflege, für die der Entlastungsbetrag bedarfsreduzierend eingesetzt wird, ist nur der jeweils geltend gemachte Bedarf zu übernehmen.
Für den Personenkreis nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gilt das SGB XII entsprechend. Die Leistungen nach dem 7. Kapitel des SGB XII sind entsprechend anzuwenden.
Für den Personenkreis nach § 3 AsylbLG gilt § 6 AsylbLG.
Auf die Verwaltungsanweisungen zum AsylbLG wird verwiesen.
Nach § 65 SGB XII haben pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 2-5 Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt.
Die stationäre Pflege soll nachrangig eintreten. Erst wenn die häusliche Pflege, die teilstationäre Pflege oder die Kurzzeitpflege den Pflegebedarf nicht mehr abdecken können, soll eine dauerhafte vollstationäre Versorgung erfolgen.
Die vorrangigen Pflegeleistungen nach dem SGB XI sind im ersten Teil dieser Verwaltungsanweisung beschrieben. Die allgemeinen Bestimmungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII sind im zweiten Teil dieser Verwaltungsanweisung dargestellt.
Seit dem 01.01.2017 besteht im SGB XI ein Anspruch auf vollstationäre Pflege unabhängig davon, ob häusliche oder teilstationäre Pflege tatsächlich möglich ist. Damit ist auch eine Prüfung zur Erforderlichkeit der vollstationären Pflege nicht notwendig, sie ist auch kein Gegenstand der ab dem 01.01.2017 geltenden Begutachtungs-Richtlinien.
Der sozialhilferechtliche Umgang bei einem angemeldeten Bedarf an Hilfe zur Pflege für eine stationäre Versorgungsform richtet sich nach den allgemeinen Regelungen des § 9 Abs. 2 und § 13 Abs. 1 SGB XII (u. a. Prüfung der Angemessenheit, Vorrang ambulanter Leistungen). Eine Prüfung dessen kann bestenfalls jedoch nur erfolgen, wenn vor einem Zuzug in eine Einrichtung der vollstationären Pflege Kontakte zum Sozialhilfeträger bestanden und eine entsprechende Beratung möglich gewesen ist.
Für die Aufnahme in eine Einrichtung der Kurzzeitpflege greift ein Genehmigungsverfahren entweder durch die Pflegekasse oder bei Nichtversicherten über den Sozialdienst Erwachsene, da in diesen Fällen zu prüfen ist, ob eine häusliche Pflege bzw. teilstationäre Pflege als ausreichend einzustufen ist (§§ 42 SGB XI, 64h SGB XII).
In Einzelfällen ist auch in der stationären Pflege eine Sprachmittlung durch neutrale Sprachmittler notwendig (beispielsweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Aufnahme in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung oder bei einer Begutachtung des Pflegegrades). In diesen Fällen besteht die Möglichkeit, den Dolmetscherdienst Bremen für die Sprachmittlung zu beauftrage.
Inanspruchnahme:
Es ist der kommunale Dolmetscherdienst Bremen in Anspruch zu nehmen.
Die an dem Verfahren beteiligten Dienste beurteilen die Notwendigkeit der Inanspruchnahme in eigener Verantwortung. Diese Beurteilung ist verbindlich. Stellt der Sozialdienst Erwachsene die Notwendigkeit der Inanspruchnahme eines Dolmetschers fest, informiert er die begutachtende Pflegefachkraft des Gesundheitsamtes entsprechend.
Kosten:
Die Kosten werden in einem vom Amt für Soziale Dienste mit der Performa Nord abgestimmten Verfahren durch die Haushaltsabteilung der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport nach Zeichnung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit überwiesen.
Dolmetscherdienst Handlungshilfe
Die vollstationäre Versorgung erfolgt durch die Einrichtung im sozialhilferechtlichen Dreieck. Der Begriff der Einrichtung ist in § 13 SGB XII definiert. Danach sind Einrichtungen im Sinne von § 13 Abs. 1 SGB XII alle Einrichtungen, die der Pflege, der Behandlung oder sonstigen nach dem SGB XII zu deckenden Bedarfe oder der Erziehung dienen. Keine Einrichtung i. S. d. § 13 SGB XII sind die besonderen Wohnformen nach dem SGB IX zur Erbringung von Eingliederungshilfeleistungen.
Die vollstationäre Pflege umfasst sämtliche erforderliche pflegerische Leistungen. Der Pflegebedarf einer pflegebedürftigen Person soll vollumfänglich gedeckt werden unabhängig von sich variierenden pflegerischen Bedarfen im Einzelfall. Der Bedarf an stationärer Hilfe zur Pflege orientiert sich an den stationären Pflegebedarf des SGB XI und ist damit inhaltsgleich.
Zu den pflegerischen Bedarfen bzw. Aufwendungen bei vollstationärem dauerhaften Aufenthalt gehören insbesondere:
Die Pflegekassen erbringen die Leistungen in vollstationären Einrichtungen gem. § 43 Abs. 2 SGB XI in je nach Pflegegrad pauschalierter Höhe. Die Leistungen umfassen die pflegebedingten Aufwendungen, die Aufwendungen der sozialen Betreuung und die Aufwendungen der medizinischen Behandlungspflege. Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von der Pflegekasse grundsätzlich nicht übernommen.
Der Anspruch beträgt je Kalendermonat:
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 2 | 770,00 € |
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 3 | 1.262,00 € |
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 4 | 1.775,00 € |
• | für pflegebedürftige Personen des Pflegegrades 5 | 2.005,00 €. |
Wählen Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 vollstationäre Pflege, wird ein Zuschuss von 125,00 € monatlich gewährt.
Gem. § 84 Abs. 2 SGB XI sind für die Pflegesätze im vollstationären Bereich in den Pflegegraden 2 bis 5 für die jeweilige Pflegeeinrichtung gleich hohe Beträge für die nicht von der Pflegeversicherung gedeckten Kosten vorzusehen (einrichtungseinheitliche Eigenanteile). Diese werden ausgehend von dem jeweiligen Versorgungsaufwand abzüglich der Summe des Leistungsbetrags nach § 43 SGB XI für die Pflegegrade 2 bis 5 ermittelt. Damit wird erreicht, dass der von der pflegebedürftigen Person bzw. vom zuständigen Sozialhilfeträger zu tragende Eigenanteil nicht mit der Schwere der Pflegebedürftigkeit steigt. Im Sinne der pflegebedürftigen Person und ihrer Angehörigen erfolgt eine bessere finanzielle Planbarkeit sowie Vergleichbarkeit und individuelle Kalkulation.
Um eine finanzielle Überforderung der vollstationär versorgten pflegebedürftigen Personen in den Pflegegraden 2-5 zu vermeiden, wird der von den pflegebedürftigen Personen zu tragende Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen (einrichtungseinheitlicher Eigenanteil) einschließlich der Ausbildungsumlagen mit zunehmender Dauer der vollstationären Pflege schrittweise reduziert. Seit dem 01.01.2022 reduziert sich dieser Eigenanteil erstmalig in Abhängigkeit der Dauer des Bezugs von Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43 SGB XI durch einen von der Pflegekasse zu zahlenden Leistungszuschlag.
Ein Antrag seitens der pflegebedürftigen Person auf Gewährung des Leistungszuschlages ist nicht notwendig. Die Zahlung des Leistungszuschlages erfolgt an die Pflegeeinrichtung (§ 87a Abs. 3 SGB XI).
Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben keinen Anspruch auf den Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI.
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2-5 erhalten einen Leistungszuschlag des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen in Höhe von:
Für die Ermittlung der Dauer des Bezugs von Leistungen nach § 43 SGB XI werden alle Zeiten berücksichtigt, in denen die Leistungen nach § 43 SGB XI bezogen wurden. Bei der Berechnung des Leistungszuschlages bleiben die Kosten für die Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten unberücksichtigt.
Pflegebedürftige Personen ab Pflegegrad 1 in stationären Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Einrichtungen) haben einen Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung. Zugelassene stationäre Pflegeeinrichtungen erhalten zur Erbringung der Leistungen einen Vergütungszuschlag.
Aufgabe der zusätzlichen Betreuungskräfte ist es, der pflegebedürftigen Person mehr Zuwendung, zusätzliche Betreuung und Aktivierung entgegenzubringen, einen besseren Austausch und im gewissen Maße auch mehr Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Diese Aufgaben erfolgen praktisch meist innerhalb von Gruppen innerhalb von Alltagsaktivitäten wie malen, lesen, spazieren gehen, Musik hören, kochen, Brettspiele spielen o. ä.
Im Rahmen der Leistungen der stationären Pflege nach § 65 SGB XII werden auch Betreuungsmaßnahmen durch die Träger der Sozialhilfe geleistet (für pflegeversicherte Personen erfolgt die Gewährung vorrangig über § 87b SGB XI). Im Unterschied zum SGB XI, der hierzu mit dem § 43b SGB XI die Anspruchsgrundlage für alle stationären Leistungen (Kurzzeitpflege, teilstationäre Pflege) vorsieht, sind die Betreuungsmaßnahmen in der Hilfe zur Pflege nur unmittelbarer Bestandteil der stationären Pflege nach § 65 SGB XII.
Für pflegebedürftige Personen in einer vollstationären Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 1 SGB XI, in der die Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder die soziale Teilhabe, die schulische Ausbildung oder die Erziehung von Menschen mit Behinderungen im Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen, übernehmen die Pflegekassen bis zu 266,00 € monatlich zur Abgeltung der pflegebedingten Aufwendungen. Diese Regelung bezieht sich auch auf pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 2–5 in Räumlichkeiten im Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 3 SGB XI, die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erhalten.
Wird für die Tage, an denen die pflegebedürftige Person zu Hause gepflegt und betreut wird, anteiliges Pflegegeld beansprucht, so gelten gem. § 43a Satz 4 SGB XI die Tage der An- und Abreise als volle Tage der häuslichen Pflege.
Die Kosten für eine vollstationäre Dauerpflege sind nur für die Einrichtungen anzuerkennen, die eine Entgeltvereinbarung abgeschlossen haben. Die im Rahmen der in dieser Vereinbarung vereinbarten Entgelte sind als angemessene und notwendige Kosten anzuerkennen. Für auswärtige Einrichtungen ist die mit dem dortigen Sozialhilfeträger geschlossene Entgeltvereinbarung anzuwenden.
Der Inhalt der Leistung bestimmt sich nach § 43 SGB XI, dem Bremischen Landesrahmenvertrag nach § 79 Abs. 1 SGB XII (BremLRV SGB XII) und der Vergütung aus den einzelnen Vergütungsvereinbarungen gem. § 85 SGB XI für Leistungen der vollstationären Pflege.
Inhalt der Pflegeleistungen sind die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Unterstützung, zur teilweisen oder zur vollständigen Übernahme der Aktivitäten im Ablauf des täglichen Lebens oder zur Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Durchführung der Aktivitäten. Die Hilfen sollen insbesondere diejenigen Maßnahmen enthalten, die Pflegebedürftigkeit mindern sowie einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit und der Entstehung von Sekundärerkrankungen vorbeugen. Damit fallen auch die Kosten der Fußpflege regelmäßig unter die allgemeinen Pflegeleistungen und können nicht als Zusatzleistungen abgerechnet werden. Es ergibt sich nur bei einer krankheitsbedingten Diagnose ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB V, z. B. bei Vorliegen eines „diabetischen Fußes“ (VO vom Podologen ist notwendig).
Die Durchführung und Organisation der Pflege richten sich nach dem allgemeinen Stand der medizinisch-pflegerischen Erkenntnisse. Die Pflegeleistungen sind in Form der aktivierenden Pflege unter Beachtung der Qualitätsvereinbarung nach § 80 SGB XI zu erbringen.
Aus dem BremLRV SGB XII und der Vergütungsvereinbarung ergibt sich die Abwesenheitsregelung.
Abwesenheiten von bis zu 3 Tagen führen zu keiner Reduzierung der Vergütung (BremLRV SGB XII). Diese Frist gilt bei jeder erneuten vorübergehenden Abwesenheit als neu eintretend.
Ab dem 4. Tag richtet sich die Vergütung bei vorübergehender Abwesenheit nach den jeweiligen Vergütungsvereinbarungen der einzelnen Einrichtungen. In Bremen ist vereinbart, dass ab dem 4. Tag vorübergehender Abwesenheit eine Vergütung von 75% des vereinbarten Pflegesatzes geleistet wird. Bei vorübergehender Abwesenheit ist die Einrichtung für einen Abwesenheitszeitraum von 42 Tagen im Kalenderjahr verpflichtet, den Pflegeplatz freizuhalten. Für diesen Zeitraum ist auch der auf 75% reduzierte Pflegesatz zu leisten. Darüberhinausgehende Ansprüche werden nicht abgeleitet.
Für auswärtige Einrichtungen ist die mit dem dortigen Sozialhilfeträger geschlossene Entgeltvereinbarung anzuwenden.
Zum Erhalt und zur Förderung einer selbständigen Lebensführung sowie zur Erleichterung der Pflege und Linderung der Beschwerden der pflegebedürftigen Personen sind Pflegehilfsmittel gezielt einzusetzen. Zu ihrem Gebrauch ist seitens der Einrichtung entsprechend anzuleiten. Stellt die Pflegekraft bei der Pflege fest, dass Pflegehilfsmittel oder technische Hilfen erforderlich sind, veranlasst sie die notwendigen Schritte. Bei der Auswahl sonstiger geeigneter Hilfsmittel ist die pflegebedürftige Person zu beraten.
Die Abgrenzung der Leistungspflicht für notwendige Hilfsmittel bei Bewohnern/innen in stationären Pflegeeinrichtungen kann nicht allgemeinverbindlich und rein produktspezifisch vorgenommen werden. Vielmehr ist in der Praxis jeder einzelne Versorgungsfall insbesondere auch unter Berücksichtigung der Einrichtungs- und Bewohnerstruktur der stationären Pflegeeinrichtung individuell zu prüfen.
Pflegeheime haben für die im Rahmen des üblichen Pflegebetriebes notwendigen Hilfsmittel zu sorgen. Sie sind verpflichtet, die pflegebedürftigen Personen ausreichend und angemessen zu pflegen, sozial zu betreuen und mit medizinischer Behandlungspflege zu versorgen (§ 43 und 43a SGB XI).
Die GKV ist für medizinisch notwendige, individuell für die einzelnen versicherten Personen angepassten Hilfsmittel, die ihrer Natur nach nur für die einzelnen versicherten Personen bestimmt und grundsätzlich nur für diese verwendbar sind, leistungspflichtig. Sie hat auch für Produkte einzustehen, die regelmäßig zur Befriedigung eines allgemeinen Grundbedürfnisses außerhalb der stationären Einrichtung oder zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben benötigt werden.
In Zweifelsfällen wird die Krankenkasse - ggf. unter Einbeziehung des MD - entscheiden, ob das beantragte Hilfsmittel vom Träger der vollstationären Pflegeinrichtung bereitzustellen oder ob das Hilfsmittel von der GKV zu zahlen ist.
Die Pflegekassen sind lediglich für die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln im häuslichen Bereich zuständig, da der § 40 SGB XI in der Systematik des SGB XI den Leistungen bei häuslicher Pflege zugeordnet ist. Die Begrenzung auf die häusliche Pflege ist sachgerecht, weil Pflegehilfsmittel im Pflegeheim wegen der dort vorhandenen Ausstattung regelmäßig nicht mehr benötigt werden. Eine Kostenübernahme für Pflegehilfsmittel durch die soziale Pflegeversicherung ist für Pflegeheimbewohner/innen nicht möglich.
Zur Vorhaltepflicht eines Pflegeheimes gehören nur Matratzen, die allgemein der Prophylaxe dienen, ohne dass tatsächlich ein Dekubitus besteht. Ist ein Dekubitus diagnostiziert und eine Dekubitus-Matratze aus medizinischer oder pflegewissenschaftlicher notwendig, handelt es sich um ein Hilfsmittel, das der Krankenbehandlung dient und der versicherten Person von der Krankenkasse zur Verfügung zu stellen ist.
Auch Rollstühle unterliegen unter bestimmten Umständen der Vorhaltepflicht der Pflegeheime. Dies ist immer dann der Fall, wenn die pflegebedürftige Person aufgrund einer kurzfristigen und vorübergehenden Einschränkung nicht in der Lage ist, Transfers innerhalb und außerhalb der Einrichtung zu bewältigen. Besteht eine dauerhafte Indikation für die Notwendigkeit eines Rollstuhls gehört dieses nicht mehr zur Vorhaltepflicht der vollstationären Dauerpflege. Wird ein Rollstuhl als Hilfsmittel verordnet, fällt dieses Hilfsmittel in den Leistungsbereich nach dem SGB V.
Eine differenzierte Beschreibung der einzelnen Hilfen ist im Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI beschrieben.
Zur Beseitigung des Mangels an Ausbildungsplätzen in der Altenpflege und Pflege wird in Bremen ein Ausgleichsverfahren zur Aufbringung der Mittel für die Kosten der Ausbildungsvergütung durchgeführt. Sowohl ambulante, teilstationäre als auch stationäre Pflegeeinrichtungen (d. h. ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeheime, Tagespflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen) haben Abgaben zu entrichten, die wiederum die pflegebedürftige Person in Rechnung gestellt werden dürfen.
Die Umlage ist in der Hilfe zur Pflege zu übernehmen, wenn ein ambulanter, teilstationärer oder stationärer Leistungserbringer entsprechende Leistungen erbringt, die sozialhilferechtlich notwendig und anerkannt worden sind.
Das Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz) trat stufenweise ab Juli 2017 in Kraft. Die bis dahin im Altenpflegegesetz und im Krankenpflegegeldgesetz getrennt geregelten Pflegeausbildungen wurden in diesem Pflegeberufegesetz zusammengeführt. Die Kosten der Ausbildung dieser Pflegeausbildung werden durch einen Ausgleichsfond finanziert. In Bremen wurde die Verordnung zur Finanzierung der Pflegeausbildung im Land Bremen in Kraft gesetzt. Die daraus resultierenden und seitens des Statistischen Landesamtes Bremen errechneten Umlagen können im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII übernommen werden.
Die investitionsbedingten Aufwendungen (Bereitstellung und Erhaltung der betriebsnotwendigen Anlagen einschl. ihrer Ausstattung) werden von den Pflegekassen aus Mitteln des SGB XI nicht übernommen.
Das Pflegesatzreferat der Behörde hat mit Leistungsanbietern der ambulanten, der teilstationären und der stationären Pflege Vereinbarungen gem. §§ 75 SGB XII geschlossen, die vorsehen, dass investitionsbedingte Aufwendungen in der vereinbarten Höhe aus Mitteln der Sozialhilfe übernommen werden, sofern im Einzelfall
• ein Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach den Bestimmungen des 7. Kapitels des SGB XII besteht und
• die sozialhilferechtlichen Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung vorliegen.
Die Investitionskosten sind mit den Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII (bei PG 2-5) zu gewähren.
Die stationären Leistungen werden nach der sogenannten 3-Säulen-Berechnung errechnet. Mit dieser Berechnungsmethode erfolgt eine Trennung zwischen den Fachleistungen der Hilfe zur Pflege (§ 65 SGB XII) einerseits und den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (§ 27b SGB XII) andererseits.
Die Norm des § 27b Abs. 1 SGB XII regelt die Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt als existenzsichernden Anteil in teilstationären und stationären Einrichtungen. In stationären Einrichtungen umfassen die Leistungen den Regelbedarf, die zusätzlichen Bedarfe nach dem Zweiten Abschnitt des Dritten Kapitels sowie die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Weiterhin werden nach § 27b Abs. 2 SGB XII als weiterer notwendiger Lebensunterhalt ein angemessener Barbetrag zur persönlichen Verfügung sowie eine Bekleidungspauschale gewährt.
Hintergrund ist, dass laufende Leistungen zum Lebensunterhalt grundsätzlich nur außerhalb von Einrichtungen erbracht werden. Für die Hilfe zum Lebensunterhalt während des Aufenthalts in Einrichtungen ist daher eine besondere Vorschrift notwendig. Während des Aufenthalts in einer Einrichtung wird der größte Teil des laufenden Lebensunterhalts durch die Einrichtung gedeckt, die ihre Kosten allerdings ganz oder teilweise von der betreuten Person oder über Pflegesätze von Sozialleistungsträgern erhält (Komplexleistung). Dennoch benötigt die betreute Person für die Befriedigung einiger laufender Bedürfnisse, die nicht von der Einrichtung gedeckt werden, einen gewissen Barbetrag.
Die Vorschrift des § 27b SGB XII spricht von „bestimmungsgemäßer Verwendung“ des Barbetrags, ohne zu umschreiben, wofür er zu verwenden ist. Ist die bestimmungsgemäße Verwendung nicht möglich, ist der Barbetrag zu mindern (§ 27b Abs. 3 S. 2 Hs. 2 SGB XII). Gemeint ist zunächst die Befriedigung der persönlichen Bedürfnisse i. S. v. § 27a Abs. 1 SGB XII. Daneben kommen indes noch andere Bedarfe in Betracht, die durch den Barbetrag zu decken sind. Dies folgt bereits daraus, dass der Barbetrag regelmäßig mindestens 27 % des Eckregelsatzes beträgt und damit höher ist als der Anteil im Regelsatz, der für die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse gedacht ist. Deshalb sind mit dem Barbetrag etwa auch Bedarfe aus den Bedarfsgruppen „Körperpflege“, „Reinigung“ oder „Instandsetzung von Kleidung“ zu decken.
Der Bedarf an Bekleidung ist im Rahmen einer pauschalierten Leistung nach § 27b Abs. 2 SGB XII zu bewilligen. Die Pauschale setzt sich dem Grunde nach aus dem Bedarf an Bekleidung und dem Bedarf an Schuhen zusammen. Auf die dazugehörige Verwaltungsanweisung wird verwiesen.
Im den folgenden Schritten wird die Berechnungssystematik entsprechend der gesetzlichen Regelungen des SGB XII bei einem dauerhaften stationären Aufenthalt dargestellt.
In der ersten Säule wird der grundsätzliche Anspruch auf Grundsicherungsleistungen im Alter und bei voller dauerhafter Erwerbsminderung geprüft und errechnet (§ 27b Abs. 1 und 2 SGB XII).
Der Anspruch nach dem 4. Kapitel SGB XII hat Vorrang vor dem Anspruch nach dem 3. Kapitel SGB XII. Es ist daher zunächst zu prüfen, ob die leistungsberechtigte Person die persönlichen Voraussetzungen zum Bezug der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII erfüllt.
Der Bedarf nach dem 4. Kapitel setzt sich zusammen aus dem Regelbedarf, den pauschalierten Unterkunftskosten und bei Bestehen der Anspruchsvoraussetzungen und der Bedarfslage den Mehrbedarf und den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung.
Sofern das bereinigte Einkommen dem Bedarf entspricht oder ihn übersteigt, ist dieser damit gedeckt und es besteht kein Anspruch auf Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.
Sofern ein Anspruch besteht, fließt dieser Anspruch als Einkommen in die Berechnung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel (2. Säule) und eventuell in die Berechnung der weiteren Hilfen des 7. Kapitels (3. Säule) ein.
Diese Säule beginnt mit der Berechnung des „fiktiven“ Bedarfes nach dem 3. Kapitel. „Fiktiv“ (so auch im Bescheid formuliert) deshalb, weil er der Höhe nach dem Bedarf des notwendigen Lebensunterhalts der Grundsicherung entspricht, diesem aber gegenüber nachrangig und pauschaliert ist und zusätzlich ergänzt um die weiteren notwendigen Lebensunterhaltsleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt wird.
Der Gesamtbedarf dieser Hilfe zum Lebensunterhalt ergibt sich in der Regel aus der Summe
Dieser Gesamtbedarf wird dem Einkommen, zu dem auch der in der 1. Säule errechnete Anspruch nach dem 4. Kapitel zählt, gegenübergestellt und geprüft, ob sich ein Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt ergibt.
In dieser Säule wird der Bedarf der stationären Maßnahme ermittelt und unter Berücksichtigung der Ansprüche nach dem 4. und 3. Kapitel SGB XII und dann unter Berücksichtigung des einzusetzenden Einkommens die Leistung berechnet.
ein 70jähriger Mensch lebt in einer Einrichtung der Dauerpflege in Bremen, Pflegegrad 3, Einkommen 200 € Rente (Stand: 01-2024).
1. Säule: Berechnung des Anspruchs nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung)
Regelbedarf (RBS 3) | 451,00 € |
KdU – pauschal | 497,18 € |
Summe der Bedarfe | 948,18 € |
abzüglich Einkommen | 200,00 € |
Anspruch 4. Kapitel | 748,18 € |
2. Säule: Berechnung des Anspruchs nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Regelbedarf (RBS 3) | 451,00 € | |
KdU – pauschal | 497,18 € | |
fiktiver HLU- | 948,18 € | |
Barbetrag § 35 SGB XII | 152,01 € | |
Bekleidung | 27,68 € | |
Summe der Bedarfe: | 1.127,87 € | |
abzüglich Einkommen | 200,00 € | |
abzüglich Einkommen | 748,18 € | (Anspruch 4. Kapitel) |
Anspruch 3. Kapitel | 179,69 € |
3. Säule: Berechnung des Anspruchs nach dem 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege)
Maßnahmekosten | 2.900,00 € | |
abzüglich Pflegevers. | 1.350,00 € | (pauschalierte Pflegelstg. inkl. Zuschlag Eigenanteil) |
abzüglich Einkommen | 948,18 € | (fiktiver HLU- |
Anspruch 7. Kapitel: | 601,82 € |
Somit ergeben sich folgende zu bewilligende Leistungen:
Anspruch 4. Kapitel | 748,18 € |
Anspruch 3. Kapitel | 179,69 € |
Anspruch 7. Kapitel | 601,82 € |
Gesamtanspruch | 1.529,69 € |
2. Beispiel
ein 75jähriger Mensch lebt in einer Einrichtung der Dauerpflege in Bremen, Pflegegrad 3, Einkommen 1.300 € Rente (Stand: 01-2024).
1. Säule: Berechnung des Anspruchs nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung)
Regelbedarf (RBS 3) | 451,00 € |
KdU – pauschal | 497,18 € |
Summe der Bedarfe | 948,18 € |
abzüglich Einkommen | 1.300,00 € |
Anspruch 4. Kapitel | 0,00 € |
2. Säule: Berechnung des Anspruchs nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Regelbedarf | 451,00 € |
KdU – pauschal | 497,18 € |
fiktiver HLU- | 948,18 € |
Barbetrag § 35 SGB XII | 152,01 € |
Bekleidung | 27,68 € |
Summe der Bedarfe: | 1.127,87 € |
abzüglich Einkommen | 1.300,00 € |
Anspruch 3. Kapitel | 0,00 € |
3. Säule: Berechnung des Anspruchs nach dem 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege)
Maßnahmekosten | 2.900,00 € | |
abzüglich Pflegevers. | 1.350,00 € | (pauschalierte Pflegelstg. inkl. Zuschlag Eigenanteil) |
abzüglich Einkommen | 948,18 € | (fiktiver HLU- |
Bedarf 7. Kapitel: | 601,82 € |
Der Einkommenseinsatz bezogen auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege ist entsprechend der §§ 85 ff SGB XII zu prüfen und zu berechnen.
Die enterale Ernährung (Sondennahrung) ist eine Form der künstlichen Nahrungsversorgung, bei der die Nahrungszufuhr über den Magen-Darm-Trakt verläuft, ohne dass der Mund-Rachen-Raum genutzt wird. Die enterale Ernährung ist immer dann notwendig, wenn eine Person nicht mehr in der Lage ist, (feste) Nahrung in ausreichender Menge zu schlucken. Eine enterale Ernährung bedarf immer der ärztlichen Verordnung. Krankenversicherte Personen haben nach § 31 SGB V einen Anspruch auf bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung. Die dafür gewährten Leistungen seitens der Krankenkasse wirken bedarfsreduzierend bezogen auf die in der Vergütungsvereinbarung festgelegten Sätze zur Verpflegung in stationären Einrichtungen.
Durch das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz vom 23.10.2020 wurde mit Wirkung zum 29.10.2020 die neue Vorschrift des § 37c in das SGB V eingeführt:
§ 37c Außerklinische Intensivpflege
(1) Versicherte mit einem besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege haben Anspruch auf außerklinische Intensivpflege. Ein besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege liegt vor, wenn die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich ist. Der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege umfasst die medizinische Behandlungspflege, die zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erforderlich ist, sowie eine Beratung durch die Krankenkasse, insbesondere zur Auswahl des geeigneten Leistungsorts nach Abs. 2. Die Leistung bedarf der Verordnung durch eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt, die oder der für die Versorgung dieser Versicherten besonders qualifiziert ist. Die verordnende Vertragsärztin oder der verordnende Vertragsarzt hat das Therapieziel mit der versicherten Person zu erörtern und individuell festzustellen, bei Bedarf unter Einbeziehung palliativmedizinischer Fachkompetenz. Bei Versicherten, die beatmet werden oder tracheotomiert sind, sind mit jeder Verordnung einer außerklinischen Intensivpflege das Potenzial zur Reduzierung der Beatmungszeit bis hin zur vollständigen Beatmungsentwöhnung und Dekanülierung sowie die zu deren Umsetzung notwendigen Maßnahmen zu erheben, zu dokumentieren und auf deren Umsetzung hinzuwirken. Zur Erhebung und Dokumentation nach Satz 6 sind auch nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärztinnen oder Ärzte/Ärztinnen oder nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Krankenhäuser berechtigt; sie nehmen zu diesem Zweck an der vertragsärztlichen Versorgung teil. Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nummer 6 bis zum 31. Oktober 2021 jeweils für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, für junge Volljährige, bei denen ein Krankheitsbild des Kinder- und Jugendalters weiterbesteht oder ein typisches Krankheitsbild des Kinder- und Jugendalters neu auftritt oder ein dem Kindesalter entsprechender psychomotorischer Entwicklungsstand vorliegt, und für volljährige Versicherte getrennt das Nähere zu Inhalt und Umfang der Leistungen sowie die Anforderungen
1. an den besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege nach Satz 2,
2. an die Zusammenarbeit der an der medizinischen und pflegerischen Versorgung beteiligten ärztlichen und nichtärztlichen Leistungserbringer, insbesondere zur Sicherstellung der ärztlichen und pflegerischen Versorgungskontinuität und Versorgungskoordination,
3. an die Verordnung der Leistungen einschließlich des Verfahrens zur Feststellung des Therapieziels nach Satz 5 sowie des Verfahrens zur Erhebung und Dokumentation des Entwöhnungspotenzials bei Versicherten, die beatmet werden oder tracheotomiert sind und
4. an die besondere Qualifikation der Vertragsärztinnen oder VertragsÄrzte/Ärztinnen, die die Leistung verordnen dürfen.
(2) Versicherte erhalten außerklinische Intensivpflege
1. in vollstationären Pflegeeinrichtungen, die Leistungen nach § 43 des Elften Buches erbringen,
2. in Einrichtungen im Sinne des § 43a Satz 1 in Verbindung mit § 71 Abs. 4 Nummer 1 des Elften Buches oder Räumlichkeiten im Sinne des § 43a Satz 3 in Verbindung mit § 71 Abs. 4 Nummer 3 des Elften Buches,
3. in einer Wohneinheit im Sinne des § 132l Abs. 5 Nummer 1 oder
4. in ihrem Haushalt oder in ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, in Schulen, Kindergärten und in Werkstätten für behinderte Menschen.
Berechtigten Wünschen der Versicherten ist zu entsprechen. Hierbei ist zu prüfen, ob und wie die medizinische und pflegerische Versorgung am Ort der Leistung nach Satz 1 sichergestellt ist oder durch entsprechende Nachbesserungsmaßnahmen in angemessener Zeit sichergestellt werden kann; dabei sind die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände zu berücksichtigen. Über die Nachbesserungsmaßnahmen nach Satz 3 schließt die Krankenkasse mit der versicherten Person eine Zielvereinbarung, an der sich nach Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs weitere Leistungsträger zu beteiligen haben. Zur Umsetzung der Zielvereinbarung schuldet die Krankenkasse nur Leistungen nach diesem Buch. Die Feststellung, ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 und den Sätzen 1 bis 3 erfüllt sind, wird durch die Krankenkasse nach persönlicher Begutachtung des Versicherten am Leistungsort durch den Medizinischen Dienst getroffen. Die Krankenkasse hat ihre Feststellung jährlich zu überprüfen und hierzu eine persönliche Begutachtung des Medizinischen Dienstes zu veranlassen. Liegen der Krankenkasse Anhaltspunkte vor, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 und den Sätzen 1 bis 3 nicht mehr vorliegen, kann sie die Überprüfung nach Satz 7 zu einem früheren Zeitpunkt durchführen. Ist die Feststellung nach Satz 6 oder die Überprüfung nach den Sätzen 7 und 8 nicht möglich, weil der oder die Versicherte oder eine andere an den Wohnräumen berechtigte Person sein oder ihr Einverständnis zu der nach den Sätzen 6 bis 8 gebotenen Begutachtung durch den Medizinischen Dienst in den Wohnräumen nicht erteilt hat, so kann in den Fällen, in denen Leistungen der außerklinischen Intensivpflege an einem Leistungsort nach Satz 1 Nummer 3 oder Nummer 4 erbracht oder gewünscht werden, die Leistung an diesem Ort versagt und der oder die Versicherte auf Leistungen an einem Ort im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 oder Nummer 2 verwiesen werden.
(3) Erfolgt die außerklinische Intensivpflege in einer vollstationären Pflegeeinrichtung, die Leistungen nach § 43 des Elften Buches erbringt, umfasst der Anspruch die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für die Betreuung und die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege in der Einrichtung unter Anrechnung des Leistungsbetrags nach § 43 des Elften Buches, die betriebsnotwendigen Investitionskosten sowie die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung nach § 87 des Elften Buches. Entfällt der Anspruch auf außerklinische Intensivpflege auf Grund einer Besserung des Gesundheitszustandes, sind die Leistungen nach Satz 1 für sechs Monate weiter zu gewähren, wenn eine Pflegebedürftigkeit des Pflegegrades 2, 3, 4 oder 5 im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 4 Nummer 2 bis 5 des Elften Buches festgestellt ist. Die Krankenkassen können in ihrer Satzung bestimmen, dass die Leistungen nach Satz 1 unter den in Satz 2 genannten Voraussetzungen auch über den in Satz 2 genannten Zeitraum hinaus weitergewährt werden.
(4) Kann die Krankenkasse keine qualifizierte Pflegefachkraft für die außerklinische Intensivpflege stellen, sind der versicherten Person die Kosten für eine selbstbeschaffte Pflegefachkraft in angemessener Höhe zu erstatten. Die Möglichkeit der Leistungserbringung im Rahmen eines persönlichen Budgets nach § 2 Abs. 2 Satz 2, § 11 Abs. 1 Nummer 5 des Fünften Buches in Verbindung mit § 29 des Neunten Buches bleibt davon unberührt.
(5) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung an die Krankenkasse den sich nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag, begrenzt auf die ersten 28 Kalendertage der Leistungsinanspruchnahme je Kalenderjahr. Versicherte, die außerklinische Intensivpflege an einem Leistungsort nach Abs. 2 Satz 1 Nummer 4 erhalten und die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten als Zuzahlung an die Krankenkasse abweichend von Satz 1 den sich nach § 61 Satz 3 ergebenden Betrag, begrenzt auf die für die ersten 28 Kalendertrage der Leistungsinanspruchnahme je Kalenderjahr anfallenden Kosten.
(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt über das Bundesministerium für Gesundheit dem Deutschen Bundestag bis Ende des Jahres 2026 einen Bericht über die Erfahrungen mit der Umsetzung des Anspruchs auf außerklinische Intensivpflege vor. Darin sind insbesondere aufzuführen:
1. die Entwicklung der Anzahl der Leistungsfälle,
2. Angaben zur Leistungsdauer,
3. Angaben zum Leistungsort einschließlich Angaben zur Berücksichtigung von Wünschen der Versicherten,
4. Angaben zu Widerspruchsverfahren in Bezug auf die Leistungsbewilligung und deren Ergebnis sowie
5. Angaben zu Satzungsleistungen der Krankenkassen nach Abs. 3 Satz 3.
Die Vorschrift gewährt bei entsprechender Erforderlichkeit Leistungen der Intensivpflege für Personen mit besonders hohem medizinischen Behandlungspflegebedarf. Diese Leistungen können im Rahmen der heutigen medizintechnischen Möglichkeiten innerhalb von Krankenhäusern, aber auch außerklinisch gewährt werden.
Außerklinische Orte für die Erbringung der Intensivpflege stellen dar:
Hintergrund der Einführung des § 37c SGB V ist, dass pflegebedürftige Menschen vermehrt bereits zu einem frühen Zeitpunkt aus dem Krankenhaus entlassen werden, um in den eigenen vier Wänden oder in Pflegeeinrichtungen gepflegt werden zu können. Zudem können auf diese Weise Personen mit Tracheostoma zur Beatmungsentwöhnung und Dekanülierung auch außerhalb von Krankenhäusern behandelt werden.
Personen mit einem hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege haben Anspruch auf Intensivpflege. Diese Voraussetzung liegt vor, wenn die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft erforderlich ist.
Personen mit bestehender Notwendigkeit einer intensivpflegerischen Versorgung können folgende Kriterien erfüllen:
Aus der Gesetzesbegründung geht hervor, dass „der anspruchsberechtigte Personenkreis nach § 37c SGB V im Wesentlichen der Personenkreis, der nach bisherigem Recht aufgrund eines besonders hohen Bedarfs an medizinischer Behandlungspflege auch bei Unterbringung in stationären Pflegeeinrichtungen ausnahmsweise Anspruch auf häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 2 Satz 3 SGB V hatte, ist“.
Über das Vorliegen der Voraussetzung des vorhandenen hohen Bedarfs an medizinischer Behandlungspflege entscheidet nach Begutachtung durch den Medizinischen Dienst die jeweilige Krankenkasse.
Für die Gewährung von Leistungen der außerklinischen Intensivpflege bedarf es einer ärztlichen Verordnung durch einen Vertragsarzt/einer Vertragsärztin. Weiterhin müssen die Einrichtungsträger Vereinbarungen über die Vergütung und Abrechnung mit den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen entsprechend § 132l SGB V geschlossen haben.
Im Land Bremen existieren mit Stand 03/2022 folgende sogenannte „Phase F – Eirichtungen“:
Leistungen der Hilfe zur Pflege sind nachrangig gegenüber Leistungen nach dem SGB XI oder SGB V zu erbringen.
Erfolgt die Intensivpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung (§ 71 Abs. 2 SGB XI), die Leistungen nach § 43 SGB XI erbringt, trifft § 37c Abs. 3 S. 1 SGB V eine Sonderregelung zum Umfang des Anspruchs, der die Grenzen zwischen Kranken- und Pflegeversicherung verschiebt. Die Krankenkasse hat dann neben den Aufwendungen der Behandlungspflege die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für die Betreuung und darüber hinaus die betriebsnotwendigen Investitionskosten sowie die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung nach § 87 SGB XI zu tragen. Die versicherte Person erhält damit von der Kasse umfassend alle Aufwendungen für die Pflege einschließlich der sonst von ihr selbst zu tragenden Kostenanteile für Unterkunft und Verpflegung (§ 87 SGB XI). Angerechnet wird der von der Pflegekasse zu tragende Leistungsbetrag nach § 43 Abs. 2 SGB XI, dessen Höhe vom Pflegegrad abhängt. Ferner trifft Abs. 3 S. 2 eine Sonderregelung zur Anspruchsdauer. Während bei Intensivpflege an einem anderen Leistungsort der Anspruch entfällt, wenn wegen einer Besserung des Gesundheitszustandes kein besonders hoher Versorgungsbedarf mehr besteht, können in einer stationären Pflegeeinrichtung in diesem Fall die nach Abs. 3 S. 1 geschuldeten Leistungen noch für weitere sechs Monate beansprucht werden, sofern mindestens der Pflegegrad 2 vorliegt. Die übergangsweise Weitergewährung des Leistungsumfangs der außerklinischen Intensivpflege in stationären Einrichtungen soll vermeiden, dass abrupt das bisherige Versorgungssetting beendet wird und den versicherten Personen ggf. die Organisation der Weiterversorgung außerhalb der Einrichtung ermöglichen (BT-Drs. 19/20720, 56). Zusätzlich räumt S. 3 den Krankenkassen die Möglichkeit ein, in ihrer Satzung über die sechs Monate hinaus die Weitergewährung der Leistung nach S. 1 zu regeln, obwohl die Voraussetzungen für den Anspruch auf außerklinische Intensivpflege nach Abs. 1 eigentlich entfallen sind.
Angerechnet wird der von der Pflegekasse zu tragende Leistungsbetrag nach § 43 Abs. 2 SGB XI, dessen Höhe vom Pflegegrad abhängt. Der ab dem 01.01.2022 zu leistende Zuschlag nach § 43c SGB XI wird zwar nicht benannt - es ist allerdings davon auszugehen, dass aufgrund des Rechtsanspruchs ohne Ermessensspielraum der in vollstationären Einrichtungen untergebrachten pflegebedürftigen Personen auf Gewährung eines Zuschlags, dieser auch vorrangig einzusetzen ist und somit die Leistungen des SGB V mindert.
Lediglich anfallende Kosten für die Ausbildungsumlagen könnten einen Bedarf an Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII auslösen, existenzsichernde Leistungen (z. B. Barbetrag, Bekleidung) sind entsprechend der sozialhilferechtlichen Voraussetzungen zu prüfen.
Krankenversicherte Personen mit einer intensivpflegerischen Versorgung haben Zuzahlungsbeträge im Sinne von § 61 SGB V zu tragen. Diese Zuzahlungen können nicht aus Mitteln der Hilfe zur Pflege übernommen werden.
Erstattungsansprüche können gegenüber der Krankenkasse geltend gemacht werden (§§ 102 ff SGB X). Erstattungsansprüche verjähren gem. § 113 SGB X in 4 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der erstattungsberechtigte Leistungsträger von der Entscheidung des erstattungspflichtigen Leistungsträgers über dessen Leistungspflicht Kenntnis erlangt hat. Gem. § 111 SGB X ist der Anspruch auf Erstattung ausgeschlossen, wenn der Erstattungsberechtigte ihn nicht spätestens 12 Monate nach Ablauf des letzten Tages, für den die Leistung erbracht wurde, geltend macht. Der Lauf dieser Frist beginnt frühestens mit dem Zeitpunkt, zu dem der erstattungsberechtigte Leistungsträger von der Entscheidung des erstattungspflichtigen Leistungsträgers über seine Leistungspflicht Kenntnis erlangt hat.
In den Fällen, in denen keine Entscheidung über die Leistungspflicht durch den erstattungspflichtigen Leistungsträger ergeht, greift der 4-Jahres-Zeitraum sinngemäß. Damit gilt in diesen Fällen, dass der Anspruch auf Erstattung in 4 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres verjährt, in dem der Erstattungsanspruch entstanden ist.
Für Personen mit intensivpflegerischen Bedarf ohne bestehende Krankenversicherung sind die Kosten nach Prüfung der beschriebenen Voraussetzungen entsprechend des 5. Kapitels SGB XII zu gewähren. Auf die dazugehörigen Ausführungen wird verwiesen.
Wesentlich behinderte Menschen können sowohl die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllen wie auch die Voraussetzungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX.
§ 43a SGB XI regelt, dass für pflegebedürftige Personen der PG 2-5 in einer vollstationären Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 1 SGB XI, in der die Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder die soziale Teilhabe, die schulische Ausbildung oder die Erziehung von Menschen mit Behinderungen im Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen, die Pflegekasse bis zu 266 € monatlich zur Abgeltung der pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der Aufwendungen für Betreuung und die Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Behandlungspflege übernimmt.
Hinsichtlich der Leistungen der Pflegeversicherung in besonderen Wohnformen wird auf die dazugehörige Rahmenrichtlinie gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 BremAG SGB IX Eingliederungshilfe SGB IX, Leistungen zur Sozialen Teilhabe verwiesen.
Die Einrichtungen:
sind Einrichtungen der gerontopsychiatrischen Pflege mit dem Schwerpunkt auf Pflege/Hilfe zur Pflege.
Grundsätzlich handelt es sich bei besonderen Wohnformen für psychisch kranke Menschen mit gerontopsychiatrischem Pflegebedarf um eine vollstationäre Pflegeeinrichtung nach dem SGB XI.
Der gerontopsychiatrische Hilfebedarf geht über das, was die Pflegeversicherung erfasst, weit hinaus. Die Hilfebedarfseinschätzung der Pflegeversicherung bezieht sich hauptsächlich auf organisch/hirnorganisch bedingte Beeinträchtigungen, soweit diese regelmäßig wiederkehrenden kompensatorischen Hilfeleistungen erfordern. Überschreiten diese kompensatorisch notwendigen Hilfestellungen in ihrer Summe einen bestimmten Tageszeitwert, wird einem bestimmten Pflegegrad zugeordnet.
Voraussetzung für die Zuordnung zu einem spezialisierten gerontopsychiatrischen Heimplatz ist das Vorliegen einer seelischen Erkrankung mit entsprechender Symptomatik sowie sich daraus ergebende Verhaltensstörungen, die einen spezifischen Pflegebedarf bedingen.
Die Zuordnung darf nur erfolgen, wenn bei Vorliegen einer psychischen Erkrankung mindestens eine stark ausgeprägte Verhaltensstörung vorliegt und die notwendigen pflegerischen Maßnahmen nur im Rahmen eines spezialisierten gerontopsychiatrischen Heimes durchgeführt werden können und vorhandene häusliche, ambulante und teilstationäre Hilfen nicht ausreichen.
Die Hilfeleistungen haben bezogen auf die vorliegenden psychischen Beeinträchtigungen sowohl eine kompensatorische als auch eine rehabilitative Funktion im Sinne aktivierender Pflege.
Vergütung und Buchung der Leistungen
Für die Vergütung gelten die gültigen Entgeltvereinbarungen und die vereinbarten Ergänzungsleistungen. Die gerontopsychatrischen Einrichtungen haben mit dem zuständigen Träger der Sozialhilfe eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung dahingehend, dass auch Leistungen der Hilfe zur Pflege gem. § 61 ff. SGB XII gewährt werden können.
Für die Erstbegutachtung sind in der Regel die Behandlungszentren (Gesundheit) zuständig.
Die Erstbewilligung der Leistungen kann erfolgen, wenn der Bedarf einer gerontopsychiatrischen Pflege beschrieben und begutachtet ist. Als ausreichend für diese Beurteilung stellt grundsätzlich eine Stellungnahme inkl. Zusatzbogen der begutachtenden Stelle dar.
Bei der Einschätzung einer gerontopsychiatrischen Erkrankung ist in der Regel von einem dauerhaften Bedarf auszugehen, deshalb ist zurzeit von einer Folgebegutachtung abzusehen.
Für Menschen die an einer Erkrankung leiden, die progredient verläuft (Finalphase) und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat oder bei denen eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische Behandlung erforderlich ist, die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von wenigen Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt und solange eine Krankenhausbehandlung im Sinne des § 39 SGB V nicht erforderlich ist, wird eine stationäre oder teilstationäre Hospizunterbringung angeboten (z. B. seitens der Hospiz-Brücke). Voraussetzung ist weiterhin, dass eine ambulante Versorgung im eigenen Haushalt oder der Familie nicht erbracht werden kann.
Ziel der Hospizversorgung ist es, unheilbar Kranken, insbesondere in der letzten Lebensphase, ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod zu ermöglichen.
Eine palliativ-medizinische Behandlung in einem Hospiz kommt typischerweise bei einer der folgenden Krankheitsbilder in Betracht:
Die Notwendigkeit einer stationären Hospizversorgung muss ärztlich „bestätigt“ werden.
Die Notwendigkeit einer stationären Hospizversorgung liegt grundsätzlich nicht bei Personen vor, die in einer stationären Pflegeeinrichtung versorgt werden. In Einzelfällen kann, soweit die angemessene Finalpflege und Sterbebegleitung in stationären Pflegeeinrichtungen nicht möglich ist, unter o. g. Voraussetzungen abgewichen werden.
Eine Behandlung wird als palliative Behandlung bezeichnet, wenn sie auf die besonderen persönlichen Bedürfnisse und medizinischen Erfordernisse Sterbender ausgerichtet ist, bei denen keine ursächliche, sondern nur noch eine symptomatische Behandlung möglich ist.
Finanzierung der Kosten für die Hospizleistung
Auf Grundlage des § 39a SGB V besteht ein Anspruch auf Gewährung eines Zuschusses durch die jeweilige Krankenkasse. Dabei trägt die Krankenkasse die zuschussfähigen Kosten unter Anrechnung der Leistungen nach dem SGB XI zu 95%. Die Zuschussbewilligung ist nachrangig gegenüber den Leistungen anderer Sozialleistungsträger. Insbesondere die Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI sind vorrangig in Anspruch zu nehmen (in Betracht kommen Leistungen der teil-/stationären Pflege sowie der Kurzzeitpflege).
Die restlichen 5% sind durch das Hospiz in Form von Spenden, ehrenamtlicher Mitarbeit, Mitgliedbeiträgen und sonstigen Zuwendungen aufzubringen.
Die Pflegekasse leistet zunächst bezogen auf den zuschussfähigen Bedarfssatz (in Höhe des in der Satzung zu § 39a SGB V festgesetzten Betrages) von dem Pflegegrad unabhängige Leistungen nach § 42 und § 39 SGB XI (Verhinderungs- und Kurzzeitpflege). Ab dem 57. Tag des Aufenthaltes in der Hospizversorgung erfolgen Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43 SGB XI in abhängiger Höhe von dem Pflegegrad. Besteht ein Leistungsanspruch nach dem SGB XI und ist mindestens ein Pflegegrad 2 festgestellt, ergibt sich nach der gültigen Entgeltvereinbarung kein Eigenanteil.
Ein Zuschuss des Sozialhilfeträgers ist vorbehaltlich der Einkommens- und Vermögensprüfung als Hilfe nach § 65 SGB XII im Rahmen der vollstationären Hilfe zur Pflege in Höhe des nach Abzug der vorrangigen Leistungen noch verbleibenden Betrages zu übernehmen.
Für Personen ohne bestehende Krankenversicherung ist eine Kostenübernahme im Rahmen des 5. Kapitels SGB XII möglich.
Grundlage für die Kostensätze und der Verfahrensweise ist die aktuelle Vergütungsvereinbarung für stationäre Hospizversorgung zwischen der AOK Bremen/Bremerhaven, dem BKK LV NS-Bremen, dem IKK LV Bremen, dem VdAK Bremen, dem AEV Bremen und der Freien Hansestadt Bremen, sowie der Zentrale für Privat Fürsorge.
Pflegebedürftige Personen der Pflegegrade 2-5 haben für eine Übergangszeit Anspruch auf Kurzzeitpflege gem. § 64h SGB XII, wenn die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Tagespflege nicht ausreicht.
Die Pflege in Form der Kurzzeitpflege ist eine vollstationäre Versorgung über Tag und Nacht. Die Kurzzeitpflege ist nur als eine Maßnahme für einen begrenzten Übergangszeitraum angedacht, z. B.
Dieser Grundsatz des § 42 SGB XI gilt auch für die Anerkennung der Notwendigkeit im SGB XII. Die Begutachtung und Bewertung von versicherten Personen erfolgt nach Antragstellung bei den jeweiligen Pflegeversicherungen durch deren Medizinischen Dienst (MD). Aufgrund der Begutachtung des MD erfolgt eine Entscheidung durch die Pflegekasse.
Für den Umfang der Leistungen nach § 64h SGB XII gelten die für die Pflegeversicherung vorgeschriebenen zeitlichen und betragsmäßigen Begrenzungen nicht. Die vereinbarten Kosten für Unterkunft, Verpflegung sowie Investitionskosten sind, anders als in der Pflegeversicherung, Bestandteil der Leistung nach § 64h SGB XII.
Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften, wie z. B. § 39c SGB V (Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürftigkeit oder bei Pflegegrad 1) gehen den Leistungen nach § 64h SGB XII vor.
Die Kurzzeitpflege erfolgt grundsätzlich in Einrichtungen der Pflege, die nach §§ 71 und 72 SGB XI zugelassen sind. Ausnahmsweise kann die Kurzzeitpflege durch geeignete Leistungserbringer der Eingliederungshilfe erbracht werden (z. B. wenn die Kurzzeitpflege in einer Einrichtung nach §§ 71 und 72 SGB XI nicht möglich oder zumutbar ist - § 42 Abs. 3 SGB XI).
Begutachtung bei Kurzzeitpflege unterhalb des Pflegegrades 2:
Eine Pflegebedürftigkeit wird nach dem SGB XI verneint, wenn diese nicht von Dauer ist. Nach dem SGB XII könnte eine Anspruchsberechtigung bestehen, da diese nicht von Dauer sein muss (§ 61 SGB XII). Von Bedeutung kann dieser Sachverhalt insbesondere bei der Kurzzeitpflege sein (vorübergehende Pflegebedürftigkeit nach Krankenhausaufenthalt). Liegen hierfür Anhaltspunkte vor, ist das Gesundheitsamt bzw. Behandlungszentrum zu beauftragen, ein Gutachten zu erstellen. Dieses Verfahren leiten die zuständigen Sozialdienste ein. Sofern eine Pflegebedürftigkeit weiterhin nicht vorliegen sollte oder lediglich ein Pflegegrad 1 festgestellt wird, kann als Anspruchsgrundlage für die Finanzierung der Kurzzeitpflege der § 39c SGB V in Frage kommen.
Abgrenzung Kurzzeitpflege - Dauerpflege
Eine Überschreitung der zeitlichen Vorgaben der Pflegeversicherung ist bei der Finanzierung der Kosten einer Kurzzeitpflege nach § 64h SGB XII im Grundsatz möglich. Nach Ablauf der zeitlichen Vorgabe, das sind bis zu 8 Wochen, ist eine erneute Prognose über die Dauer des Aufenthaltes in der Kurzzeitpflege abzugeben. Eine kurze Überschreitung aus Gründen, die im § 42 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB XI genannt sind (siehe oben), ist möglich. Sollten längere Aufenthalte notwendig sein, ist vollstationäre Dauerpflege angezeigt.
Genehmigungspraxis bei Kurzzeitpflege nach einem Krankenhausaufenthalt.
Die Verbände der Pflegekassen im Lande Bremen haben vereinbart, die Leistungen der Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI, die direkt nach einer stationären Krankenhausversorgung im Sinne des § 39 SGB V stattfindet, nur noch mit Pflegeeinrichtungen zu genehmigen, die über einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI für Leistungen nach § 42 SGB XI verfügen (sogenannte Solitäreinrichtungen). Das bedeutet, dass Streubetten in Einrichtungen der vollstationären Dauerpflege zu diesem Zweck in der Regel nicht mehr finanziert und somit nicht belegt werden können.
Für Personen, die nicht pflegeversichert sind und für die der Träger nach SGB XII die Kosten der Kurzzeitpflege zu tragen hat, gilt die oben dargestellte Regelung analog. Dies heißt, dass die Kosten für Kurzzeitpflege nach Krankenhausbehandlung grundsätzlich nur für die Versorgung in Einrichtungen mit einem entsprechenden Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI übernommen werden können.
Es bestehen diesbezüglich folgende Ausnahmen:
Leistungen
Die Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Aufwendungen der sozialen Betreuung in pauschalierter Höhe. Der Sozialhilfeträger übernimmt gem. § 64h SGB XII die Leistungen inkl. Unterkunftskosten, Verpflegung und Investitionskosten in der mit dem Einrichtungsträger vereinbarten Höhe, wenn die Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichend sind.
Die nach § 75 SGB XII anerkannten Einrichtungen der vollstationären Dauerpflege bieten in der Regel auch Kurzzeitpflegeplätze an. Für diese sogenannten „Streubetten“ bestehen keine gesonderten Vereinbarungen, so dass für die Kurzzeitpflege die Vergütung für die vollstationäre Dauerpflege anzuwenden ist. Für Kurzzeitpflege im Anschluss eines Krankenhausaufenthaltes sind nur die Kosten der nach § 42 SGB XI anerkannten Kurzzeitpflegeinrichtungen zu übernehmen.
In Fällen der Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI und der Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI wird die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes (§ 37 SGB XI) bei der Kurzzeitpflege für bis zu acht Wochen je Kalenderjahr und bei der Verhinderungspflege bis zu sechs Wochen je Kalenderjahr weitergezahlt.
Das von der Pflegekasse nach § 37 SGB XI gezahlte hälftige Pflegegeld nach dem SGB XI ist auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach § 64h SGB XII für die Kurzzeitpflege nicht anzurechnen.
Bei ergänzender Kurzzeitpflege ist in der Regel die zeitliche Begrenzung gem. § 42 SGB XI verbindlich. Ist ein längerer Aufenthalt notwendig, beurteilt der Sozialdienst die Notwendigkeit eines längeren Aufenthaltes in der Kurzzeitpflege.
Im Rahmen der Leistungen der stationären Pflege nach § 65 SGB XII werden auch Betreuungsmaßnahmen durch die Träger der Sozialhilfe geleistet (für pflegeversicherte Personen werden diese Leistungen vorrangig im Rahmen von § 87b SGB XI erbracht). Im Unterschied zum SGB XI, der hierzu mit dem § 43b (zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen) die Anspruchsgrundlage für alle stationären Leistungen (Kurzzeitpflege, teilstationäre Pflege) vorsieht, sind die Betreuungsmaßnahmen in der Hilfe zur Pflege nur unmittelbarer Bestandteil der stationären Pflege nach § 65 SGB XII (und deshalb nicht nach § 64h SGB XII Leistungsgrundlage für die Kurzzeitpflege).
Die für Kurzzeitpflege vorrangigen Leistungen sind zu berücksichtigen. Neben den Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI, können dieses auch Leistungen der Krankenversicherung nach § 39c SGB V sein.
Der entsprechende Entlastungsbetrag kann bedarfsmindernd eingesetzt werden.
Seit dem 01.07.2021 besteht ein Anspruch auf Übergangspflege im Krankenhaus, wenn nach Abschluss der medizinischen Behandlung im Krankenhaus die Versorgung nicht anders sichergestellt werden kann (§ 39e SGB V). Dies betrifft auch die Fälle, deren Versorgung beispielsweise im Rahmen einer Kurzzeitpflege oder durch andere Leistungen nach dem SGB XI nicht sichergestellt werden kann. In diesen Situationen erbringt die Krankenkasse Leistungen der Übergangspflege im Krankenhaus für längstens 10 Tage je Krankenhausbehandlung. Voraussetzung ist, dass die vorherige Krankenhausbehandlung abgeschlossen ist. Die Übergangspflege umfasst die Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, die Aktivierung des Versicherten, die Grund- und Behandlungspflege, ein Entlassmangagement, Unterkunft und Verpflegung sowie die im Einzelfall erforderliche Behandlung.
Es muss eine Vergütungsvereinbarung im Sinne von § 132m SGB V vorliegen, um den Anspruch umsetzen zu können.
Im Folgenden werden mögliche Konkurrenzen bzw. Zweckidentitäten anderer Leistungen in Bezug auf die Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege dargestellt.
Menschen mit Behinderungen und gleichzeitigem Bedarf an pflegerischen Leistungen erhalten oft eine Kombination aus Leistungen der Eingliederungshilfe des SGB IX, der Pflegeversicherung nach dem SGB XI und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.
In der „Rahmenrichtlinie gem. § 5 Abs. 2 BremAG SGB XII – Eingliederungshilfe“ wird das Verhältnis der Eingliederungshilfeleistungen, Leistungen der Pflege und Leistungen der Hilfe zur Pflege beschrieben. In § 13 SGB XI wird in Abs. 3 deutlich, dass Leistungen der Eingliederungshilfe und Leistungen der Pflege nach dem SGB XI gleichrangig nebeneinanderstehen. Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII sind nachrangig gegenüber den Leistungen der Pflege nach dem SGB XI zu betrachten.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass entscheidend für die Zuordnung der einzelnen Leistungen die Zielsetzung ist, die für die in Frage stehenden Leistungen überwiegend bestimmt ist. Hilfe zur Pflege ist grundsätzlich dann zu gewähren, soweit bei Personen, die wegen einer Behinderung der Hilfe bedürfen, die Erhaltung und Sicherung der vorhandenen Lebensmöglichkeiten im Vordergrund steht.
Grundsätzlich sind neben den stationären Leistungen des SGB XI/SGB XII auch Leistungen der Eingliederungshilfe möglich.
Pflegebedürfte Personen ab PG 2 haben bei Vorliegen der Voraussetzungen Zugang zum vollen Leistungsangebot nach dem SGB XI, bzw. der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII. Damit verankert ist u. a. auch die Möglichkeit der Gewährung der Kosten eines Aufenthalts im Rahmen einer Kurzzeitpflege. Personen mit PG 1 oder fehlender Pflegebedürftigkeit haben keinen Zugang auf Gewährung der Kosten für eine Kurzzeitpflege nach dem SGB XI oder dem 7. Kapitel des SGB XII (lediglich auf die Zielsetzung des Entlastungsbetrages bei PG 1 wird verwiesen).
Seit dem 01.01.2016 besteht ein Leistungsanspruch bei der Unterstützung durch Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 37 Abs. 1a SGB V), auf Versorgung durch Haushaltshilfen (§ 38 SGB V) und auf Leistungen für Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürftigkeit und bei PG 1 (§ 39c SGB V) wegen schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere
Voraussetzungen sind, dass keine Pflegebedürftigkeit ab PG 2 nach dem SGB XI gegeben ist (z. B. weil der Unterstützungsbedarf nur von kurzer Dauer ist) und nicht andere, insbesondere im Haushalt lebende Personen die notwendigen Unterstützungsleistungen übernehmen können.
Der Anspruch bei der Haushaltshilfe ist nach § 38 SGB V auf 4 Wochen begrenzt. Der Anspruch verlängert sich auf längstens 26 Wochen, wenn im Haushalt ein Kind lebt, welches bei Beginn der Haushaltshilfe das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder welches behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Als Satzungsleistungen können die Krankenkassen bei der Haushaltshilfe nach § 38 SGB V über den Pflichtleistungsanspruch hinausgehende Ansprüche vorsehen, die z. B. eine längere Leistungsdauer regeln.
Der Leistungsanspruch auf Kurzzeitpflege ist an die Leistungsdauer, Leistungshöhe und an die Leistungsinhalte des § 42 SGB XI angelehnt. Die Kurzzeitpflege kann in zugelassenen Einrichtungen nach dem SGB XI oder in anderen geeigneten Einrichtungen erbracht werden. Ein Anspruch auf eine Leistungserhöhung oder Verlängerung des zeitlichen Leistungsanspruchs nach § 42 Abs. 2 Satz 3 SGB XI wegen Nichtinanspruchnahme von Verhinderungspflege besteht in diesen Fällen nicht.
Ziel der stationären Hospizversorgung ist es, eine Pflege und Begleitung (palliativ-pflegerische Behandlung und Pflege) anzubieten, welche die Lebensqualität des sterbenden Menschen verbessert, seine Würde nicht antastet und aktive Sterbehilfe ausschließt. Bei stationären Hospizen handelt es sich um kleine Einrichtungen mit familiärem Charakter mit in der Regel 8 bis höchsten 16 Plätzen. Versicherte Personen, die an einer fortschreitend verlaufenden Erkrankung leiden, bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische und eine palliativ-pflegerische Versorgung notwendig ist, haben Anspruch auf einen Zuschuss zu stationärer oder teilstationärer Versorgung in Hospizen gem. § 39a Abs. 1 SGB V.
Weitere Voraussetzungen sind, dass
Die Krankenkassen leisten einen Zuschuss zum stationären Hospizaufenthalt in Höhe von 95 Prozent des mit dem jeweiligen Hospiz vereinbarten tagesbezogenen Bedarfssatzes. Der Zuschuss wird unter Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung auf Antrag gewährt. Der Eigenanteil an den zuschussfähigen Kosten in Höhe von 5 Prozent des tagesbezogenen Bedarfssatzes ist durch das Hospiz über Spenden aufzubringen. Die Versicherten müssen für den Hospizaufenthalt keine Eigenanteile zahlen. Für nicht krankenversicherte Personen gelten die Regelungen des 5. Kapitels SGB XII.
Einer Aufstockung im Rahmen der Hilfe zur Pflege bedarf es dann nicht.
Gem. § 4 Abs. 1 des Bremischen Gesetzes über die Gewährung von Pflegegeld an blinde und schwerstbehinderte Menschen (Landespflegegeldgesetz, LPGG) werden die Leistungen der Pflegeversicherung oder andere Leistungen, die dem Ausgleich behinderungsbedingter Mehraufwendungen dienen, in voller Höhe auf die Leistungen des LPG angerechnet. Die Anrechnung bezieht sich auf die häuslichen, als auch auf die stationären Leistungen nach dem SGB XI.
Selbstzahler/innen in stationären Pflegeeinrichtungen mit Ansprüchen nach dem SGB XI bzw. vergleichbaren Leistungen haben anrechnungsbedingt keinen Anspruch auf Landespflegegeld.
In der Weisung zu § 4 Abs. 3 Landespflegegeldgesetz ist ausgeführt, dass Menschen, die nach Anrechnung der stationären Leistungen nach dem SGB XI bzw. vergleichbaren Leistungen anteilige Kosten der stationären Pflege durch den Sozialhilfeträger erhalten, ein Pflegegeld in Höhe von 50 % des Grundbetrages nach § 2 Abs. 1 LPGG zu zahlen ist.
Das Landespflegegeld nach dem Bremischen Landespflegegeldgesetz stellt eine gleichartige Leistung im Sinne von § 63b Abs. 1 Satz 3 SGB XII dar, auch wenn das Landespflegegeld wegen Blindheit geleistet wird. Das Landespflegegeld ist auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege anzurechnen.
Gem. § 72 SGB XII wird blinden Menschen zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt. Im § 72 Abs. 5 SGB XII ist die Anspruchsberechtigung beschrieben. Diese Anspruchsberechtigung ist mit der im Landespflegegeldgesetz genannten Anspruchsberechtigung für blinde Menschen identisch.
Die Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz sind vorrangige Leistungen, d. h. im ersten Schritt ist ein Anspruch auf die Leistungen nach dem LPGG zu prüfen.
Gem. § 72 Abs. 3 SGB XII steht auch blinden Menschen in einer stationären Einrichtung Blindenhilfe zu. Im § 72 Abs. 3 Satz 1 SGB XII ist formuliert, dass sich dieser Anspruch um höchstens 50% vermindert, wenn die Kosten der Einrichtung ganz oder teilweise aus Mitteln öffentlich-rechtlicher Leistungsträger getragen werden. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsträgern gehören in diesem Kontext alle Leistungsträger, die für den Aufenthalt in der Einrichtung zweckbestimmt Leistungen gewähren, z. B. der Sozialhilfeträger, die Pflegeversicherung oder die gesetzliche Krankenversicherung.
Die Blindenhilfe mindert sich um den Betrag, den der oder die öffentlich-rechtlichen Leistungsträger für die Kosten der Einrichtung aufbringen, jedoch um höchstens 50%. In der Regel wird eine Minderung um 50% zutreffend sein, da zu den Aufwendungen nicht nur die Kosten des Sozialhilfeträgers, sondern auch die der Pflegeversicherung zugeordnet werden.
Zweck der Minderung ist, dass in Einrichtungen regelmäßig ein großer Teil der notwendigen pflegerischen und sonstigen Betreuung wahrgenommen wird, so dass blinden Menschen geringere blindheitsbedingte Mehraufwendungen entstehen, als wenn sie außerhalb einer Einrichtung leben würden. So soll vermieden werden, dass doppelt öffentliche Leistungen gewährt werden. Daraus folgt, dass wenn der blinde Mensch die Kosten des stationären Aufenthaltes selbst trägt, d. h. der blinde Mensch keine Leistungen eines öffentlich-rechtlichen Leistungsträgers im Sinne des § 72 Abs. 3 SGB XII in Anspruch nimmt, eine Minderung des Anspruchs nach § 72 Abs. 3 SGB XII nicht in Betracht kommt. Die blindenbedingten Mehraufwendungen brauchen nicht gesondert nachgewiesen werden.
Zu beachten ist, dass gem. § 72 Abs. 4 SGB XII bei Bezug von Blindenhilfe ein Barbetrag nach § 35 Abs. 2 SGB XII nicht zu gewähren ist.
Die Bestimmungen des 11. Kapitels finden entsprechende Anwendung.
Beispielberechnung:
Anspruchsberechtigung für Landespflegegeld wegen Blindheit, Anspruch auf Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und Leistungen der vollstationären Dauerpflege nach SGB XI und SGB XII
01.01.2024 | |||
247,49 € | 50% LPG wg. Blindheit | gem. § 4 Abs. 3 LPGG | 1. Schritt: |
841,77 € | Blindenhilfe nach § 72 SGB XII | 2. Schritt: | |
bis zu | Minderung | § 72 Abs. 3 SGB XII | |
420,89 € | geminderte Blindenhilfe | ||
- | LPG wg.Blindheit | § 72 Abs. 1 Satz 1 SGB XII | |
173,80 € | Blindenhilfe | ||
Leistungen: | |||
247,09 € | LPG | ||
173,80 € | Blindenhilfe Maßnahmekosten |
Im Nachfolgenden werden die wichtigsten einzelnen Reformstufen der leistungsrechtlichen Regelungen im SGB XI – beginnend mit den letzten Reformstufen - beschrieben.
Mit dem Pflegeunterstützungs- und entlastungsgesetz (PUEG) werden Leistungsverbesserungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen auf den Weg gebracht. Die finanzielle Lage der sozialen Pflegeversicherung soll stabilisiert, die Arbeitsbedingungen für beruflich Pflegende verbessert und die Digitalisierung in der Langzeitpflege gestärkt werden. Zum 01.01.2024 wird das Pflegegeld um 5% angehoben, gleichzeitig werden auch die Leistungsbeträge für ambulante Sachleistungen um 5% angehoben. Zum 01.01.2025 steigen alle Leistungsbeträge der Pflegeversicherung (sowohl im häuslichen wie auch im teil- und vollstationären Bereich) in Höhe von 4,5% an. Zum 01.01.2028 ist eine weitere Erhöhung geplant, die sich am Anstieg der Kerninflationsrate in den drei vorausgehenden Kalenderjahren orientiert. Sämtliche Leistungsbeträge der Geld- und Sachleistungen der Pflegeversicherung werden regelgebunden automatisch dynamisiert.
Zum 01.01.2024 ergeben sich Änderungen im Bereich des Pflegeunterstützungsgeldes nach § 44a SGB XI: ab diesem Zeitpunkt kann von Angehörigen pro Kalenderjahr für bis zu 10 Arbeitstage das Pflegeunterstützungsgeld je pflegebedürftiger Person in Anspruch genommen werden und ist damit nicht mehr beschränkt auf insgesamt 10 Arbeitstage.
Zum 01.07.2025 werden die Leistungsbeträge der Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege zu einem gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege gem. § 42a SGB XI zusammengefasst. Damit steht für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege künftig ein kalenderjährlicher Gesamtleistungsbetrag von bis zu € 3.539,00 zur Verfügung, der flexibel für beide Leistungsarten eingesetzt werden kann. Die zeitliche Höchstdauer der Verhinderungspflege wird auf bis zu 8 Wochen im Kalenderjahr angehoben und damit der zeitlichen Höchstdauer der Kurzzeitpflege angeglichen. Gleiches gilt sodann auch für den Zeitraum der hälftigen Fortzahlung eines zuvor bezogenen Pflegegeldes sowohl der Verhinderungspflege als auch während der Kurzzeitpflege. Ab dem 01.07.2025 entfällt das Erfordernis einer 6monatigen Vorpflegezeit vor der erstmaligen Inanspruchnahme von Verhinderungspflege.
Im Bereich der vollstationären Pflege werden zum 01.01.2024 die Leistungszuschläge, die die Pflegeversicherung nach § 43c SGB XI für Pflegebedürftige ab dem Pflegegrad 2 in vollstationären Pflegeeinrichtungen übernimmt wie folgt erhöht:
Zur Absicherung bestehender Leistungsansprüche gegenüber der sozialen Pflegeversicherung wird der reguläre Beitragssatz zum 01.07.2023 angehoben und zusätzlich nach der Kinderzahl differenziert.
Mit dem PUEG werden die Landesrahmenvertragspartner in § 75 SGB XI beauftragt, die bestehenden Verträge zu ergänzen: Es sollen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen Personalpools sowie vergleichbare betriebliche Ausfallkonzepte etablieren können.
Länder und Kommunen können gemeinsam mit der Pflegeversicherung über ein neu geschaffenes Budget Modellvorhaben für Unterstützungsmaßnahmen und –strukturen für Pflegebedürftige vor Ort und im Quartier fördern.
Entsprechend der neu eingefügten gesetzlichen Grundlage nach § 142a SGB XI besteht die Möglichkeit der Feststellung von Pflegebedürftigkeit und Einstufung in einen Pflegegrad aufgrund eines strukturierten telefonischen Interviews ergänzend oder alternativ zu einer Untersuchung des Versicherten in seinem Wohnbereich. Diesbezüglich sind entsprechende pflegewissenschaftliche Studien zugrunde zu legen. Eine Begutachtung aufgrund eines telefonischen Interviews ist ausgeschlossen, wenn
1. es sich um eine erstmalige Untersuchung der antragstellenden Person handelt, in der geprüft wird, ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind und welcher Pflegegrad vorliegt,
2. es sich um eine Untersuchung aufgrund eines Widerspruchs gegen eine Entscheidung der Pflegekasse zum festgestellten Pflegegrad handelt,
3. es sich um eine Prüfung der Pflegebedürftigkeit von Kindern handelt oder
4. die der Begutachtung unmittelbar vorangegangene Begutachtung das Ergebnis enthält, dass Pflegebedürftigkeit nicht vorliegt.
Dem Bundesministerium für Gesundheit ist bis zum 30.06.2024 ein Evaluationsbericht vorzulegen.
Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) wurde auch eine Pflegereform 2021 verabschiedet. Die darin enthaltenen Neuregelungen zum SGB XI sollen dazu beitragen, Pflegekräfte besser zu bezahlen und Pflegebedürftige zu entlasten. Dazu wurde der Beitragszuschuss für Kinderlose ab dem vollendeten 23. Lebensjahr in der gesetzlichen Pflegeversicherung von 0,25 % des Bruttogehalts um 0,1 % auf 0,35 % angehoben. Zusätzlich beteiligt sich der Bund ab 2022 mit einer Milliarde € jährlich an den Aufwendungen der sozialen Pflegeversicherung.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
Das Zweite Pflegestärkungsgesetz ist mit den wesentlichen Änderungen zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Einige wenige Änderungen gelten bereits seit dem 01.01.2016.
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz wird die seit 2006 eingeleitete Pflegereform abgeschlossen.
Zentraler Inhalt dieser Gesetzesänderung ist die neue Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes und damit verbunden auch das Neue Begutachtungsinstrument (NBI. Mit diesem Begutachtungsinstrument werden die Pflegebedürftigkeit und damit der Zugang zu den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung festgestellt.
Der Pflegebedürftigkeitsbegriff steht bereits seit seiner Einführung in der Kritik. Wesentlicher Kritikpunkt ist die verengte vorrangig auf Alltagsverrichtungen ausgerichtete Sicht in der Feststellung von Pflegebedürftigkeit. Er ist unter pflegefachlichen Gesichtspunkten nicht ausreichend fundiert und vorrangig auf Alltagsverrichtungen in den Bereichen Mobilität, Ernährung, Körperpflege und hauswirtschaftliche Versorgung ausgerichtet. Kognitive und psychische Beeinträchtigung wurden bisher nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt. Das führte dazu, dass Menschen mit kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen seltener höhere Pflegestufen erhielten, als Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.
Diese Kritikpunkte aufnehmend waren durch verschiedene Gesetzesänderungen die Leistungen der Pflegeversicherung für die Personen mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz verbessert worden (Pflege-Weiterentwicklungsgesetz, Pflege-Neuausrichtungsgesetz, Pflegestärkungsgesetz 1). Dies führte, so die Kritik des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, zu „einem unübersichtlichen Flickenteppich“. „Ohne die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wird das ’System Pflege durch weitere kleinteilige Änderungen zu einem, insbesondere für die pflegebedürftigen Personen Menschen selbst [Anmerkung: auch für die Beratungsstellen], immer unübersichtlicheren Flickenteppich“ – Quelle: Stellungnahme des Deutschen Vereins vom 23.06.2014.
Bereits 2006 wurde vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) der Expertenbeirat zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes einberufen. Der Expertenbeirat unter Mitwirkung aller relevanten Organisationen, Pflegewissenschaft und Rechtsprechung übergab den Bericht 2009 dem BMG. Zur Klärung noch offener fachlicher, administrativer und rechtstechnischer Fragen wurde 2012 erneut ein Expertenbeirat zur konkreten Ausgestaltung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes einberufen, der Abschlussbericht erfolgte 2013. Auf dieser Grundlage ist das Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) am 28.12.2015 im Bundesgesetzblatt verkündet worden.
Wesentliche Inhalte des PSG II sind unter anderem:
Am 17.10.2014 hat der Deutsche Bundestag das Erste Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung (Erstes Pflegestärkungsgesetz PSG 1) verabschiedet. Mit diesem Gesetz soll die Pflegeversicherung weiterentwickelt und zukunftsfest gemacht werden. In einem zweiten Schritt wird nach Erprobung einer neuen Begutachtungssystematik (neues Begutachtungsassessment - NBA) auf ihre Umsetzbarkeit und Praktikabilität ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt.
Der Gesetzgeber sieht im PSG 1 einen weiteren Zwischenschritt bis zur Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes. Er sieht die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Stabilisierung und flexibleren Gestaltung der häuslichen Pflege und eine weitere Verbesserung in der ergänzenden Betreuung der stationären Pflege. Mit weiteren Verbesserungen der Leistungen erfahren insbesondere Menschen mit Demenzerkrankungen eine bessere Betreuung. Durch die Einführung des Pflegevorsorgefonds wird Vorsorge für besondere Demografie bedingte Belastungen getroffen.
Wesentliche Inhalte des PSG I sind unter anderem:
Ergänzend zum PSG 1 wurde das „Gesetz zur besseren Vereinbarung von Familie, Pflege und Beruf“ verabschiedet. Die in diesem Gesetz formulierten Rechtsansprüche bieten die Möglichkeit, sich innerhalb der Familie aktiv in die Pflege von Angehörigen einzubringen. Die Möglichkeiten, die das Familienpflegezeitgesetz und das Pflegezeitgesetz bieten, werden in diesem Gesetz weiterentwickelt.
Das Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pflege-Versicherungsgesetz – SGB XI) trat bei der häuslichen Pflege ab 01.04.1995 und bei der stationären Pflege ab 01.07.1996 in Kraft. Seitdem ist das Gesetz laufend fortentwickelt worden. Mit dem Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz im Jahr 2002 und dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz im Jahr 2008 sind wichtige Ergänzungen gerade für Pflegebedürftige mit einer erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz vorgenommen worden. Die Rechte von Pflegebedürftigen Personen wurden mit der Ausweitung von Beratungspflichten der Pflegekassen und dem Aufbau von Beratungsstellen (Pflegestützpunkte) im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wesentlich gestärkt.
Diese Entwicklung setzt sich jetzt mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG) fort.
Aus der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass es einer weiteren Fortentwicklung der Leistungsangebote der Pflegeversicherung insbesondere für den Personenkreis der an Demenz erkrankten Menschen bedarf. Für die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes gibt es einen breiten Konsens. Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff ist in mehreren Schritten umzusetzen. Im Hinblick darauf, dass an Demenz erkrankte Menschen zeitnah konkrete Hilfe brauchen, werden sie durch das Pflege-Neuausrichtungsgesetz verbesserte Leistungen erhalten. Diese Leistungen werden gewährt, bis ein Gesetz in Kraft tritt, das eine Leistungsgewährung aufgrund eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs vorsieht. Die §§ 123 (verbesserte Pflegeleistungen für Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz) und 124 SGB XI (Häusliche Betreuung) sind deshalb auch nur als Übergangsbestimmungen geregelt.
Wesentliche Inhalte des PNG sind unter anderem:
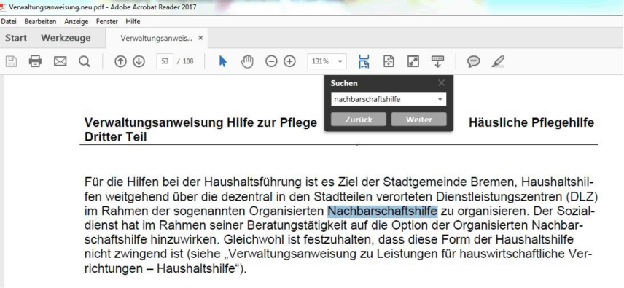
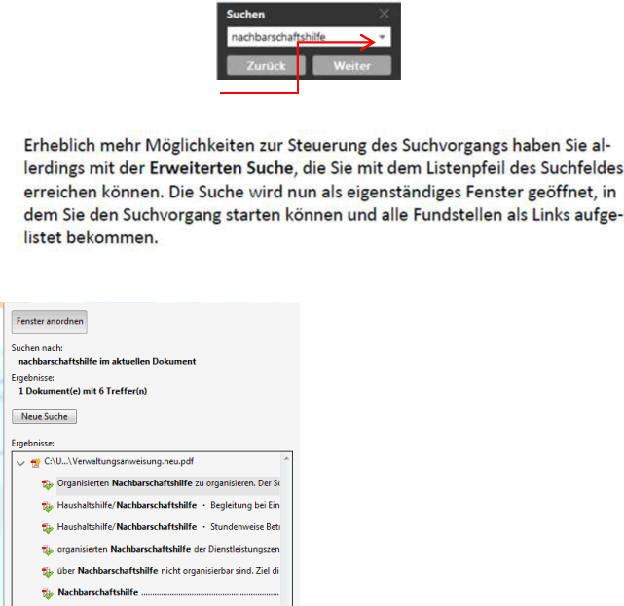
Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI vom 21.04.2020
Begutachtungsrichtlinien und Richtlinien zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit (Stand 17.05.2021)
Richtlinien zur Empfehlung von Hilfsmitteln durch Pflegefachkräfte (GKV-Spitzenverband)
Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes
Dolmetscherdienst Handlungshilfe
Intensivpflege Kostenabgrenzung
Quelle: Richtlinien zum Verfahren der Feststellung von Pflegebedürftigkeit sowie zur pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsinstruments nach dem Elften Buch des Sozialgesetzbuches (Begutachtungs-Richtlinien – BRi)
Gesetzesbegründung zu § 28a SGB XII, so auch zu § 63 Abs. 2 SGB XII
ab 1.1.2005 der § 64 SGB XII
ab 1.1.2005 der § 65 SGB XII